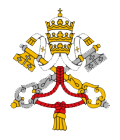Dankeswort beim Festakt anlässlich der Nachfeier meines 75. Geburtstags
an der Vinzenz Pallotti University in Vallendar am 1. November 2025
GOTT IN DIE MITTE
In Kirche und Theologie die Taubheit gegenüber Gott überwinden
Kurt Cardinal Koch
Nach dem eindrücklichen Festakt muss meine erste Antwort ein Wort des Dankes sein. Ich danke der Vinzenz Pallotti University für die Durchführung des Symposiums zum wichtigen Thema „Gott in die Mitte“ und für die Gastfreundschaft, die sie uns allen gewährt. Ich danke besonders Professor George Augustin für die Initiative zur Nachfeier meines 75. Geburtstages und für die Planung und Drucklegung der Festschrift mit dem gleichnamigen Titel.[1] Ich danke allen, die mit ihren wichtigen Beiträgen das Panorama der Gottesfrage in der Festschrift bereichert haben, und allen Referenten an unserer Tagung. Dass unter den Autoren und Referenten so viele Bischöfe zu finden sind, erfüllt mich mit Freude, bringen sie doch damit zum Ausdruck, dass ich meine Theologie stets als Dienst an und für die Kirche und in diesem Sinn als kirchliche Theologie verstanden habe. Ich danke allen, die zum heutigen Festakt beigetragen haben, vor allem auch Bischof Klaus Krämer für seine eindrückliche Laudatio. Ich kann nun meine Dankbarkeit nicht besser zum Ausdruck bringen als dadurch, dass ich meine Gedanken zum Leitwort von Festschrift und Symposium vortrage. Ich will dabei versuchen, das Leitwort „Gott in die Mitte“ in vier Themenkreisen kurz zu umreissen.
1. Gott – das zentrale Thema des Glaubens
Dass Gott in die Mitte gehört, ist zutiefst in der biblischen Botschaft begründet. Bereits im Alten Testament ergeht die Grundforderung Gottes an sein Volk: „Höre Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ (Dtn 6, 4). Und am Beginn des Neuen Testaments singt Maria ihr Loblied auf Gott und bebildert ihn im „Magnifikat“ mit vielen Tatwörtern und lässt ihr Lied münden in den Zuruf: „Meine Seele preist die Grösse des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“ (Lk 1, 46). Dabei gilt es, das „Magnifikat“ wörtlich zu nehmen. Mit ihm mutet Maria uch uns zu, Gott gross zu machen, und zwar in der Überzeugung, dass überall dort, wo Gott gross gemacht wird, der Mensch gerade nicht klein gemacht wird. Klein gemacht wird der Mensch vielmehr, wenn auch Gott mit Füssen getreten wird, wie wir es in den beiden schrecklichen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, im Nationalsozialismus und im Kommunismus bitter erfahren mussten. Dort hingegen, wo Gott gross gemacht wird, erhält auch der Mensch Anteil an der Grösse Gottes.
Dass Gott seinen Ort in der Mitte hat, ergibt sich von daher aus dem christlichen Glaubensverständnis von selbst. Denn auf die Frage, woran oder – besser – an wen wir Christen glauben, gibt das Glaubensbekenntnis der Kirche die aufschlussreiche Antwort: Wir glauben an Gott, genauer an den Dreieinen Gott: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dies ist die einfachste und zugleich komplexeste Antwort. Denn christlicher Glaube hat es mit Gott und deshalb mit der ganzen Wirklichkeit zu tun, insofern „Gott“ jenes Wort ist, das am meisten Universalität in sich schliesst. Es ist in der Sicht des Glaubens sowohl das einfachste als auch das universalste Wort. Mit ihm wird angezeigt, dass Gott viel grösser als die Kirche ist, weil Er alle Menschen angeht und ihnen gehört.
Wir Christen glauben an Gott freilich in einer Welt, in der es vielen Menschen nicht mehr gelingt, Gott als in ihrem Leben und in der Welt gegenwärtige Wirklichkeit wahrzunehmen, sie vielmehr leben, als gäbe es Gott nicht: „etsi deus non daretur“. Vielen Menschen erscheint Gott als fremd oder überflssig, und in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit wird er gleichsam auf die Ersatzbank gesetzt. Wir leiden heute weithin unter einer gewissen Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber, weshalb viele Menschen sogar vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. In dieser gesellschaftlichen Situation die Frage nach Gott zu stellen und dem Menschen von heute den Zugang zu Gott wieder zu eröffnen, setzt in erster Linie voraus, dass die religiöse Dimension des Menschseins nicht einfach als ein Epiphänomen, das man unter Umständen auch vernachlässigen kann betrachtet werden kann.
Das christlich-theologische Menschenbild geht demgegenüber von der Grundüberzeugung aus, dass die religiöse Dimension konstitutiv zum Menschsein des Menschen gehört und dass der Mensch gleichsam das unheilbar religiöse Lebewesen ist, dies freilich nicht im Sinn einer Krankheit, von der der Mensch nicht geheilt werden könnte, sondern im Sinne einer Grunddimension, die den Menschen in einem ganz elementaren Sinn auszeichnet. Dies bedeutet konkret, dass man den Menschen ohne seine religiösen Bezüge gar nicht adäquat verstehen kann. Der christliche Glaube ist deshalb um den Aufweis bemüht, dass die Weltoffenheit des Menschen, die im Licht der neuzeitlichen Anthropologie den Menschen charakterisiert, nur dann konsequent und radikal verstanden wird, wenn der Mensch als das auch über die Welt als ganze hinaus offene und folglich das Gott offene Lebewesen zu verstehen ist und dessen Weltoffenheit als Gottoffenheit ausgelegt wird.
Der Mensch ist wesensmässig das auf Gott hin offene Wesen. Darin besteht im Kern seine Gottebenbildlichkeit, wie Joseph Ratzinger diese anthropologische Fundamentalkategorie in der Heiligen Schrift auslegt, indem er sie im Anschluss an den heiligen Augustinus in der Gottfähigkeit des Menschen wahrnimmt: „Gottebenbild-Sein bedeutet die wesensmässige Offenheit für Gott, die damit als das eigentliche Konstitutivum des Menschwesens erklärt wird, so dass man gerade sagen könnte, die Gottebenbildlichkeit des Menschen besteht in seiner Gottfähigkeit, die ihm als leiblich-geistlicher Persönlichkeit eignet.“[2]
Ebenbild Gottes sein bedeutet, konkret, dass Gott selbst im Menschen eingeschrieben ist. Dafür sind die Erzengel die entscheidenden Wegweiser. Denn ihre Namen enden mit dem Wort „El“, was Gott bedeutet: Micha-El heisst „Wer ist wie Gott“, Gabri-El heisst „Meine Kraft ist Gott“, und Rafa-El heisst „Gott heilt“. Wie Gott in die Namen und damit in das Wesen der Erzengel eingeschrieben ist und wie ihr Wesen im Stehen vor Gott und im Dasein für Gott besteht, so ist auch der Christ dazu berufen, dass Gott in seinem Leben eingeschrieben ist und er in der Gegenwart Gottes lebt. Das christliche Leben besteht von daher, wie der Kirchenvater Irenäus von Lyon sehr schön gesagt hat, darin, sich an Gott zu gewöhnen, genauso wie sich Gott zuvor in seiner Menschwerdung an uns Menschen gewöhnt hat.
Für diese Gottoffenheit des Menschen erweist sich der christliche Glaube als glaubwürdige Anwältin, und zwar in einem zweifachen Sinn. Dabei geht es zuerst um die Transzendenz im urreligiösen Sinn der Wirklichkeit Gottes. Der christliche Glaube ist zutiefst überzeugt, dass dieser Transzendenzbezug dem menschlichen Leben Orientierung und Weite schenkt. Dies zeigt sich umgekehrt bereits daran, dass überall dort, wo den Menschen die religiöse Transzendenz verschlossen ist, sich ihnen der Versuch und die Versuchung aufdrängen, den Himmel Gotts gleichsam auf Erden zu suchen. Für dieses Bemühen stehen freilich in der heutigen Gesellschaft nur wenige Betätigungsfelder zur Verfügung, genauer diejenigen des Amüsements, der Arbeit und der Liebe. Von daher droht die grosse Gefahr, dass die Menschen sich zu Tode amüsieren, zu Tode arbeiten und sogar zu Tode lieben, wie prominente Fachexperten des modernen Lebens der Menschen diagnostizieren. In diesem dreifachen „zu Tode“ zeigt sich, wie befreiend und erlösend für den Menschen die wahre Transzendenzbeziehung ist, insofern sich in ihr die unverbrauchte Wahrheit des heiligen Augustinus bewährt, dass des Menschen Herz unruhig ist, bis es ruhen kann in Gott. In der Tat vermag allein die einzig masslose Wirklichkeit Gottes die einzig masslose Antwort auf die masslose Sehnsucht des menschlichen Herzens zu geben.
Wer Gott sagt, redet zweitens auch von der Ewigkeit und vom ewigen Leben des Menschen. Dies ist die zweite Transzendenzbeziehung, die für das Gelingen des menschlichen Lebens von unschätzbarer Bedeutung ist. Denn bei der Einstellung zur Glaubenswirklichkeit des ewigen Lebens geht es auch um das ureigene Lebensprogramm des Menschen. Letztlich steht der Mensch vor der Alternative: Entweder bedenkt und lebt er sein jetziges Leben im Vorausblick und in der Hoffnung auf das ewige Leben oder er findet sich resigniert mit dem real existierenden Leben ab. Wenn der Ausblick auf das ewige Leben möglich ist und trägt, dann erhält das menschliche Leben einen weiteren Horizont, und dann gewinnen wir mehr Zeit gerade in der heutigen Zeit einer weitgehenden Zeitverknappung. Die deutsche Soziologin Marianne Gronemeyer hat das Problem des heutigen Menschen mit der Zeit darin diagnostiziert, dass wir in der heutigen Zeit zwar viel länger, faktisch jedoch immer kürzer leben, und hat es auf die Kurzformel gebracht: Früher lebten die Menschen vierzig Jahre plus ewig; heute leben sie nur noch neunzig Jahre, und dies ist sehr viel weniger. In der heutigen Zeit der knapp gewordenen Zeit enthält der Glaube an das ewige Leben das Geschenk einer wunderbaren Zeitvermehrung, das dem menschlichen Leben zugutekommt.
2. Glaubensgemeinschaft der Kirche als Lebensort Gottes
Nicht nur für das Leben des einzelnen glaubenden Menschen stellt der christliche Glaube an Gott eine anthropologische Wohltat dar, sondern auch für die Glaubensgemeinschaft der Kirche als ganze.. Diese Lektion habe ich in besonderer Weise von einem Jugendlichen lernen dürfen. Als er in einer Fernsehsendung von einem Journalisten nach seinem Verhältnis zur Katholischen Kirche befragt worden ist, hat er diese einfache Antwort gegeben: „Kirche? – Mein Gott!“ Ohne es zu wissen und natürlich ohne es auch zu wollen, hat dieser Jugendliche die theologisch adäquateste und wohl auch schönste Antwort gegeben. Denn indem er das Wort „Kirche“ sofort und allein mit dem Wort „Gott“ assoziiert, kommt damit an den Tag, dass die Kirche es in allererster Linie und in letztgültiger Weise mit Gott zu tun hat. Denn Kirche kann nie ein Selbstzweck in sich sein, sondern sie ist dazu da, dass Gott in der Welt gesehen werden kann und damit ein Ausblick auf Gott entsteht.
Darin lag auch die Stossrichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das eine strikt Theo-logische Ekklesiologie vorlegen wollte und auch verabschiedet hat. Sie ist freilich in der Rezeption des Konzils nicht wirklich zum Tragen gekommen. Denn in der nachkonziliaren Zeit hat vor allem das zweite Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“, das vom „Volk Gottes“ handelt, eine grosse Kariere machen können, während demgegenüber das erste Kapitel über das „Mysterium der Kirche“ weithin in Vergessenheit geraten ist, wiewohl erst von ihm her deutlich ist, dass es in der Kirche nicht um irgendein Volk, sondern um das Volk Gottes geht. Diese Sinnrichtung hat das Konzil bereits mit dem Titel der Kirchenkonstitution zum Ausdruck gebracht; denn „Lumen gentium“ – „Licht der Völker“ ist gerade nicht die Kirche, sondern Jesus Christus, durch dessen „Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, alle Menschen erleuchtet werden“[3]. In der Sicht des Konzils gibt es Kirche, und zwar im buchstäblichen Sinn nur „um Gottes willen“.
Dieselbe Grundüberzeugung vom Primat Gottes im Leben der Kirche haben frühchristliche Theologen mit dem schönen Bild von Sonne und Mond zum Ausdruck gebracht: Wie der Mond kein Licht aus sich selbst hat, sondern alles Licht von der Sonne empfängt, um es in die Nacht hinein strahlen zu lassen, so liegt die Sendung der Kirche als Mond darin, die Sonne Gottes in die Weltnacht der Menschen hinein zu strahlen und leuchtende Hoffnung zu ermöglichen. Als glaubwürdig erweist sich deshalb nur eine lunare Kirche, die sich nicht selbst sonnen will, sondern sich damit zufriedengibt, Mond zu sein, und auf Gott als die wahre Sonne des Menschen und der ganzen Schöpfung hinweist. Die Kirche lebt deshalb nur dann evangelisch, wenn sie möglichst wenig von sich, dafür möglichst intensiv von Gott spricht.
Dem Bild von Sonne und Mond liegt die biblische Sicht von der Kirche zugrunde, wie sie in besonders dichter Weise beim alttestamentlichen Propheten Sacharja im achten Kapitel mit einer Vision aufscheint: „So spricht der Herr der Heere; in jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört: Gott ist mit euch“ (Sach 8, 23). Elementarer könnte man wohl die Herausforderung an die Glaubensgemeinschaft nicht ausdrücken. Sie tritt dann vor unsere Augen, wenn wir in unsere durchschnittliche Pastoral hineinblicken, die in umgekehrter Richtung vollzogen wird: Wir gehen den Menschen nach, packen sie am Gewand und pflegen sie zu fragen: „Wollt nicht auch ihr mit uns gehen?“ Die Verheissung Gottes durch den Propheten Sacharja ist aber eine ganz andere: Die Menschen selbst wollen mit der Glaubensgemeinschaft gehen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Gott in ihrer Mitte ist.
Die Glaubensgemeinschaft der Kirche ist somit berufen, das Wort Gottes nicht nur zu verkünden und die Gegenwart Gottes in den Sakramenten zu feiern; sie muss sich auch und vor allem als Lebensort Gottes selbst in glaubwürdiger Weise präsentieren. Die Frage nach Gott muss deshalb den Vorrang vor der Kirchenfrage haben. Der dezidierte Primat der Gottesfrage bedeutet freilich nicht, dass nicht auch von der Kirche zu handeln wäre: er muss aber implizieren, dass alles Reden von der Kirche dem Reden von Gott ein- und untergeordnet sein muss, oder, um mit George Augustin zu sprechen: „Gott zuerst“!
3. Gott als exklusives Thema christlicher Theologie
Was vom Glauben des einzelnen Christen und der Glaubensgemeinschaft der Kirche gesagt worden ist, gilt auch und vor allem von der Theologie, wie bereits der Name dieser Wissenschaft anzeigt. Denn er ordnet den Theos einem Logos zu und bringt damit zum Ausdruck, dass die Theo-Logie letztlich nur ein Thema hat, insofern es ihr zuerst und zuletzt und in der Mitte um die Wirklichkeit Gottes geht. Die Theologie ist als Denken und Sagen Gottes, genauer als Wissenschaft von Gott zu verstehen.
Die lebendige Wirklichkeit Gottes ist das exklusiv-eine Thema der theologischen Verantwortung des christlichen Glaubens. Dies gilt freilich nicht im Sinne eines abstrakten Specialissimum. Die denkerische Verantwortung des Glaubens hat vielmehr im Erkennen ihres einen Themas, nämlich Gottes, zugleich alle Wirklichkeit und damit alles, was irgendwie Inhalt der menschlichen Wirklichkeitserfahrung ist, als von Gott bestimmt mit zu erkennen und zum Verstehen zu bringen und die allgemein erfahrbare und auch aussertheologisch reflektierte Wirklichkeit in ihrer Bezogenheit auf Gott, „sub specie aeternitatis Dei“ zu thematisieren. Das exklusiv-eine Thema der Theologie, nämlich die Wirklichkeit Gottes, kann die Theologie nur dadurch in glaubwürdiger Weise verantworten, dass sie zugleich und in einem, mithin inklusiv alle Gegenstände der Wirklichkeitserfahrung und Wirklichkeitserkenntnis zum Thema macht. Denn wer es mit Gott als der alles bestimmenden und umgreifenden Wirklichkeit zu tun hat, hat es zugleich mit allem zu tun, insofern es von Gott umgriffen ist, wie der heilige Thomas von Aquin in seiner „Summa contra gentiles“ entschieden betont hat: „multa praecognoscere theologus oportet“[4]. Indem sich die Theologie vollzieht als Explikation des einen Themas Gottes, baut sie sich zugleich als Theologie der universalen Wirklichkeit auf. Nur in dieser Weise kommt die Bezeichnung „Theo-Logie“ wirklich zu Ehren.
Diese Umschreibung impliziert konkret, dass auf der einen Seite in der Theologie über Vieles gesprochen werden muss, auch über alle Fragen des Menschseins, der Weltgestaltung und auch über die Gestalt und Ordnung der Kirche, dass jedoch auf der anderen Seite das eigentliche und in gewisser Weise das einzige Thema der Theologie Gott ist, insofern sich im Letzten alle grossen Fragen auf die Gottesfrage zurückführen lassen. In diesem elementaren Sinn ist Gott gleichsam das einzige Thema der Theologie, freilich so, dass alles Andere, was auch Thema der Theologie sein kann und sein muss, im Lichte Gottes zu bedenken ist. In diesem Sinn ist eine theologischere Theo-Logie gefragt.
4. Gott als ökumenisches Thema
Die undelegierbare Verantwortung der Theologie besteht darin, die Leidenschaft und Sensibilität für die Frage nach Gott in der Kirche und Gesellschaft heute wachzuhalten, und zwar im Dienst an der Menschlichkeit des Menschen. Diese Aufgabe hat die Theologie in der heutigen Situation vornehmlich in ökumenischer Gemeinschaft wahrzunehmen, worauf vor allem Papst Benedikt XVI. hingewiesen hat. Bei seinem Besuch in Erfurt im Jahre 2011 hat er an das reformatorische Wirken Martin Luthers erinnert, für den die Frage nach Gott „die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines Lebens und seines ganzen Weges“ gewesen ist[5], und er hat diese Erinnerung auf die heutige Situation mit der Konsequenz angewandt: „Der Durst nach dem Unendlichen ist im Menschen unausrottbar da. Der Mensch ist auf Gott hin erschaffen und braucht ihn. Unser erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit muss es sein, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen und damit der Welt die Antwort zu geben, die sie braucht.“[6]
Christen glauben freilich nicht an irgendeinen Gott, sondern an den Gott, der sich in der Geschichte des Volkes Israel offenbart und in seinem Sohn sein wahres Gesicht gezeigt hat. Wie Martin Luthers Denken und seine ganze Spiritualität christozentrisch gewesen sind, so gehört auch für uns Christen in ökumenischer Gemeinschaft heute zum Grundzeugnis für Gott „ganz zentral das Zeugnis für Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, der mit uns gelebt hat, für uns gelitten hat und für uns gestorben ist und in der Auferstehung die Tür des Todes aufgerissen hat“[7].
Zentralität der Frage nach Gott und Christozentrik müssen die elementaren Perspektiven der kirchlichen Verkündigung und der christlichen Theologie sein, die in ökumenischer Gemeinschaft zu verantworten sind. Sie standen ganz im Mittelpunkt des Denkens und Wirkens von Joseph Ratzinger als Theologe, Bischof und Papst. Ihm, der ein ganzes Leben lang um die Frage nach Gott und die Antwort auf diese Frage aus der christlichen Offenbarung gerungen hat, soll deshalb das letzte Wort gelten, mit dem er zusammengefasst hat, worum es ihm gegangen ist und was auch heute im Mittelpunkt des christlichen Redens von Gott stehen muss:
„In unserer Zeit, in der der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und den Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, der am Sinai gesprochen hat; zu dem Gott, dessen Gesicht wir in der Liebe bis zum Ende (Joh 13, 1) – im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus erkennen. Das eigentliche Problem unserer Geschichtsstunde ist es, dass Gott aus dem Horizont der Menschen verschwindet und dass mit dem Erlöschen des von Gott kommenden Lichts Orientierungslosigkeit in die Menschheit hereinbricht, deren zerstörerische Wirkungen wir immer mehr zu sehen bekommen. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und des Petrusnachfolgers in dieser Zeit.“[8]
5. Berufung, „Schüler Gottes“ zu sein
„Gott in die Mitte“ ist von daher das Gebot der gegenwärtigen Kirchenstunde. Diese Herausforderung ist in aller Deutlichkeit zu Tage getreten bei der Kirchenmitgliedschaftsstudie, die in Deutschland im Jahre 2023 durchgeführt worden ist und bei der die angefragte Aussage „Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“, von nur noch 32 Prozent der katholischen Kirchenmitglieder bejaht worden ist. Diese bedenkliche Ausdünnung des Glaubensbekenntnisses, die damit sichtbar geworden ist, ruft nach einer neuen Evangelisierung, in deren Mitte die Frage nach Gott stehen muss. Diesbezüglich stellt der 1700. Jahrestag des Ersten Ökumenischen Konzils im Jahre 325 eine besondere Gelegenheit dar, dass alle Christen in ökumenischer Gemeinschaft dieses Konzils gedenken und sich sein Bekenntnis zu Jesus Christus als dem wahren Sohn Gottes, der mit seinem himmlischen Vater „wesensgleich“ ist, erneut aneignen und in der heutigen Welt verkünden.
Dies kann nur gelingen, wenn wir Christen Gott selbst in die Mitte unseres Lebens und Denkens stellen und damit „Schüler Gottes“ werden. Darin besteht die adäquate Umschreibung dessen, was einen Christen ausmacht, wie sie Jesus selbst gegeben hat, indem er sich im Rahmen seiner grossen Rede über das Himmelsbrot in der Synagoge von Kafernaum auf die Propheten zurückbezogen hat, bei denen verheissen ist, dass alle „Schüler Gottes“ sein werden (Joh 6, 45). Als Christen sind wir vollends berufen und verpflichtet, „Schüler Gottes“ immer mehr zu werden und zu sein. So hoffe ich, dass unsere Tagung dazu beiträgt, dass wir stets mehr werden, was unsere Berufung ausmacht: „Schüler Gottes“ sein.
[1] G. Augustin (Hrsg.), Gott in die Mitte. Damit Glauben gelingen kann. Für Kurt Kardinal Koch (Freiburg i. Br. 2025).
[2] J. Ratzinger, Was ist der Mensch? in: JRGS 5, 209-228, zit. 219.
[3] Lumen Gentium, Nr. 1.
[4] Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, I, 4.
[5] Benedikt XVI., Ansprache bei der Begegnung mit Vertretern des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Augustinerkloster Erfurt am 23. September 2011.
[6] Benedikt XVI., Ansprache im Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche des Augustinerklosters Erfurt am 23. September 2011.
[7] Ebda.
[8] Benedikt XVI., Brief an die Bischöfe der Katholischen Kirche in Sachen Aufhebung der Exkommunikation der vier von Erzbischof Lefebvre geweihten Bischöfe am 10. März 2009.