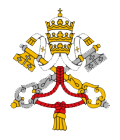ÖKUMENISCHE PERSPEKTIVEN IM BLICK AUF DAS PAPSTAMT
Gastvorlesung an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern am 13. November 2024
Herzlich danke ich der Theologischen Fakultät der Universität Luzern und besonders Frau Dekanin Margit Wasmaier-Sailer für die freundliche Einladung zum heutigen Festvortrag, Frau Professorin Nicola Ottiger für die Planung und Vorbereitung und Frau Professorin Ursula Schumacher für die Response; ich danke auch dem früheren Dekan Robert Vorholt für die Anregung, als Besucher aus Rom über die Frage des Papstamtes zu sprechen. Die Suche nach einer ökumenischen Verständigung über das Papstamt muss von einem doppelten Sachverhalt ausgehen: Auf der einen Seite ist die Katholische Kirche im Glauben überzeugt, dass der Einheitsdienst des Petrusnachfolgers ein kostbares Geschenk des Heiligen Geistes für die Kirche ist, das sie deshalb nicht für sich behalten darf, sondern verpflichtet ist, dieses Geschenk auch den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften anzubieten und zu teilen. Denn ohne Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom als dem Papst der universalen Kirche ist in katholischer Sicht eine Einheit der Kirche nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite muss die Katholische Kirche aber zur Kenntnis nehmen, dass von vielen anderen christlichen Gemeinschaften die Frage des Papstamtes als grosses Hindernis auf dem Weg zur Wiederherstellung der Einheit der Christen wahrgenommen wird. Es macht das Verdienst von Papst Paul VI. aus, dass er bei seinem Besuch im damaligen Sekretariat für die Einheit der Christen im Jahre 1967 in freimütiger und ehrlicher Weise ausgesprochen hat, dass die Frage des Papstamtes eines der schwierigten ökumenischen Probleme darstellt: „Der Papst ist, wir wissen es wohl, ohne Zweifel das schwerwiegendste Hindernis auf dem Weg des Ökumenismus.“[1]
Von daher stellt sich die Frage, wie diese gegensätzlichen Wahrnehmungen überwunden werden können und was zu tun ist, damit der Dienst des Petrusnachfolgers nicht mehr als ein Hindernis bei der Suche nach der Wiederherstellung der Einheit der Kirche betrachtet wird, sondern als ökumenische Möglichkeit oder gar Hilfe eingeschätzt werden kann. Es muss sich dabei von selbst verstehen, dass diese Frage nicht im Alleingang, sondern nur in den ökumenischen Dialogen beantwortet werden kann. Wenn deshalb im Folgenden Ökumenische Perspektiven im Blick auf das Papstamt in katholischer Sicht dargelegt werden, kann es sich nur um einen ersten Schritt handeln. Auszugehen ist dabei von der Beobachtung, dass und wie die Inhaber des Petrinischen Dienstes selbst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ihr Amt in einer ökumenischen Perspektive betrachtet und ausgeübt haben.
I. Päpstliche Einladungen zum ökumenischen Gespräch über das Papstamt
Papst Johannes Paul II. ist in seinem ökumenischen Wirken von der Überzeugung getragen gewesen, dass nach dem Ersten Jahrtausend der Christentumsgeschichte, das die Zeit der ungeteilten Kirche gewesen ist, und nach dem Zweiten Jahrtausend, das im Osten wie im Westen zu tiefen Spaltungen in der Kirche geführt hat, das Dritte Jahrtausend die grosse Aufgabe zu bewältigen hat, die verloren gegangene Einheit der Christen wiederherzustellen. In dieser ökumenischen Selbstverpflichtung hat er in seiner Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene „Ut unum sint“ im Jahre 1995 auf das ehrliche Bekenntnis von Papst Paul VI. zurückgegriffen und erklärt, dass das Amt des Bischofs von Rom „eine Schwierigkeit für den Grossteil der anderen Christen“ darstellt, „deren Gedächtnis durch gewisse schmerzliche Erinnerungen gezeichnet ist“[2]. Papst Johannes Paul II. ist aber überzeugt gewesen, dass das Amt, das dem Nachfolger des Petrus übertragen ist, in erster Linie ein Amt der Einheit ist und dass es im Bereich der Ökumene „seine ganz besondere Erklärung“ findet[3]. In dieser Überzeugung hat er im Schlussteil seiner Enzyklika „Ut unum sint“ grundlegende Gedanken dem „Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit“ gewidmet und in diesem Zusammenhang die Bitte an die eigene Kirche, aber auch an die gesamte Ökumene ausgesprochen, sich mit ihm auf einen geduldigen brüderlichen Dialog über den Primat des Bischofs von Rom einzulassen, und zwar mit dem Ziel, eine Form der Primatsausübung zu finden, „die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet“, genauer dahingehend, dass dieses Amt „einen von den einen und den anderen anerkannten Dienst der Liebe zu verwirklichen vermag“[4].
Papst Benedikt XVI. hat die von Papst Johannes Paul II. vorgenommene Unterscheidung zwischen dem Wesen des Primats und der konkreten Form seiner Ausübung verschiedentlich aufgegriffen und die damit verbundene Einladung an die Ökumene erneuert, beispielsweise bei seiner Begegnung mit Vertretern von Orthodoxen Kirchen in Freiburg i. Br. im September 2011: „Wir wissen, dass es vor allem die Primatsfrage ist, um deren rechtes Verständnis wir weiter geduldig und demütig ringen müssen. Ich denke, dabei können uns die Gedanken zur Unterscheidung zwischen Wesen und Form der Ausübung des Primates, die Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika Ut unum sint (Nr. 95) vorgenommen hat, weiterhin fruchtbare Anstösse geben.“[5] In dieser Grundhaltung hat Papst Benedikt XVI. die Ostkirchen als „echte Teilkirchen“ gewürdigt, „obwohl sie nicht mit dem Papst in Verbindung sind“. Auch wenn damit der Mangel an Einheit auch „ein innerer Mangel in der Teilkirche“ ist, ist in diesem Sinne die Einheit mit dem Papst „nicht konstitutiv für die Teilkirche“. Aus dieser doppelten Feststellung hat der Papst geschlossen: „Sie bleibt eine Zelle, sie darf Kirche heissen, aber in der Zelle fehlt ein Punkt, nämlich die Verknüpfung mit dem Gesamtorganismus.“[6] In dieser Sinnrichtung hatte Papst Benedikt XVI. als Theologe bereits in den siebziger Jahren den weitsichtigen Vorschlag unterbreitet, Rom müsse für die Wiedervereinigung vom Osten „nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde“[7].
Den von seinen Vorgängern bereiteten Weg geht heute auch Papst Franziskus in ökumenischer Offenheit weiter, indem er ebenfalls deutlich unterscheidet zwischen dem, was für den Primat des Papstes wesentlich ist, und dem, was zur konkreten und teilweise geschichtlich bedingten Form seiner Ausübung gehört, und indem er zugleich eingesteht, dass wir auf diesem Weg der Unterscheidung bisher „wenig vorangekommen“ sind[8]. Sein spezifischer Beitrag zur Vertiefung dieser Frage besteht vor allem darin, dass er die Synodalität als „konstitutive Dimension der Kirche“ als den „geeignetsten Interpretationsrahmen für das Verständnis des hierarchischen Dienstes selbst“ betrachtet und deshalb überzeugt ist, dass die Ausübung des petrinischen Dienstes in einer synodalen Kirche besser geklärt werden kann, und zwar in dieser Sinnrichtung: „Der Papst steht nicht allein über der Kirche, sondern er steht in ihr als Getaufter unter den Getauften, im Bischofskollegium als Bischof unter den Bischöfen und ist – als Nachfolger des Apostel Petrus – zugleich berufen, die Kirche von Rom zu leiten, die in der Liebe allen Kirchen vorsteht.“[9] Zumal in ökumenischer Sicht hat Papst Franziskus seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass eine „sorgfältige Untersuchung, wie im Leben der Kirche das Prinzip der Synodalität und der Dienst dessen, der den Vorsitz hat, zum Ausdruck kommen“, einen wichtigen Beitrag zur ökumenischen Versöhnung zwischen den Kirchen darstellt[10].
II. Ein möglicher Einheitsdienst in den ökumenischen Dialogen
Mit der Unterscheidung zwischen dem Wesen des päpstlichen Primats und der konkreten Form seiner Ausübung und damit auch zwischen dem Unaufgebbaren und dem Revidierbaren in der Gestalt des Papstamtes haben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil alle Päpste zum Dialog über das Papstamt eingeladen und wesentliche Schritte auf eine ökumenische Verständigung über das für die Katholische Kirche wichtige Papstamt des Bischofs von Rom hin unternommen, und zwar in der Hoffnung, dass dieses Amt nicht weiterhin das Haupthindernis für die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft darstellt, sondern auch als „Hauptmöglichkeit“ für dasselbe Anliegen betrachtet werden kann[11]. Diese Hoffnung ist in der Zwischenzeit bestätigt worden von den Entwicklungen in den ökumenischen Dialogen über das Thema von Primat und Synodalität in den vergangenen Jahrzehnten. Die vom Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen unter dem Titel „The Bishop of Rome“ erarbeitete Synthese der Antworten aus den verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften auf die Einladung von Papst Johannes Paul II., mit ihm in einen Dialog über die Ausübung des Papstamtes einzutreten, und der vielen ökumenischen Dialoge, die seither darüber geführt worden sind, zeigt, dass eine neue Offenheit für den Sinn und die Notwendigkeit eines Dienstes der Einheit auch auf der universalen Ebene der Kirche gewachsen ist.[12]
Auch im Blick auf die ökumenische Frage des Papstamtes ist es angezeigt, die „zwei besonderen Kategorien von Spaltungen“, von denen das Dekret über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“ sagt, „durch sie sei der nahtlose Leibrock Jesu Christi getroffen“ worden“, voneinander zu unterscheiden[13]. Dies bedeutet, dass sich die Frage des Papstamtes bei der Überwindung der Spaltungen in der Kirche zwischen Ost und West nicht in der gleichen Weise wie bei der ökumenischen Überwindung der Spaltungen in der Westkirche stellt. Im Folgenden können dabei noch keine allseits befriedigenden ökumenischen Konsense oder gar Lösungen dieser Frage präsentiert werden. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass die verschiedenen christlichen Konfessionen auch als ekklesiologische „Gesamtkonzeptionen des Christlichen“ verstanden werden können und dass dementsprechend hinter den verschiedenen Antworten aus der Ökumene auf die Frage nach dem Papstamt als Dienst an der Einheit der Kirche „letztlich ein unterschiedliches Verständnis dieser Einheit der Kirche“ steht[14]. Dies hat zur Konsequenz, dass in erster Linie die ekklesiologischen Grundfragen, die wesentliche Implikationen für die Papstfrage aufweisen, thematisiert werden müssen, um von daher Wege zu erkunden, auf denen künftige Konsense erreicht werden könnten.[15]
1. Das Papstamt in den Dialogen mit den Kirchen des Ostens
Der ökumenische Dialog der Katholischen Kirche mit den Kirchen des Ostens über die Frage des Papstamtes erweist sich auf der einen Seite als theologisch schwieriger denn der Dialog mit den kirchlichen Gemeinschaften im Westen. Die Kirchen des Ostens gehen theologisch von einer grundsätzlichen Gleichstellung von Sakrament und Recht aus. Da das Papstamt kein Sakrament darstellt, sondern eine spezifische Rechtsstellung, die jedoch über die sakramentale Ordnung gesetzt wird, erblicken die Kirchen des Ostens vor allem in der geschichtlichen Entwicklung des Primats des Bischofs von Rom in der Lateinischen Tradition im Zweiten Jahrtausend eine Störung oder gar Zerstörung der ekklesialen Struktur der Kirche, mit der etwas Neues an die Stelle der altkirchlichen Gestalt gestellt worden sei.
a) Der Bischof von Rom als Erster, aber mit spezifischen Funktionen?
Auf der anderen Seite erweist sich der ökumenische Dialog mit den Kirchen des Ostens als leichter denn das Gespräch mit den kirchlichen Gemeinschaften im Westen. Denn in beiden Kirchengemeinschaften ist das ekklesiologische Grundgefüge erhalten geblieben, das sich seit dem Zweiten Jahrhundert herausgebildet hat, nämlich die sakramental-eucharistische und die episkopale Grundstruktur der Kirche in dem Sinne, dass die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt in apostolischer Sukzession als für das Kirchesein konstitutiv betrachtet werden. Insofern steht unter allen christlichen Kirchen die Orthodoxie der Katholischen Kirche am nächsten.
Hinzu kommt, dass die Gemeinschaft der autokephalen oder autonomen Orthodoxen Kirchen eine Taxis, nämlich eine Rangordnung der Apostolischen Sitze in der Reihenfolge Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem und so weiter kennt und von daher anerkennt, dass der Bischof von Rom in dieser Taxis den ersten Sitz innehat, wie ihn bereits das Konzil von Nicaea definiert hat und wie er in der kirchlichen Realität im Ersten Jahrtausend festgestellt werden kann. Der eigentlich strittige Punkt besteht aber darin, dass in orthodoxer Sicht dem Bischof von Rom allein ein Ehrenprimat im Sinne des Prinzips „Primus inter pares“ zukommt, während er in katholischer Sicht auch über bestimmte juridische Kompetenzen verfügen muss: „Der Papst ist Erster – und hat auch spezifische Funktionen und Aufgaben.“[16] In dieser Differenz besteht die elementare Frage, die in den weiteren ökumenischen Dialogen mit den Ostkirchen intensiv besprochen werden muss.
Im offiziellen ökumenischen Dialog zwischen der Katholischen und der Orthodoxen Kirche konnte auf der Vollversammlung der Gemischten Internationalen Kommission in Ravenna im Jahre 2007 ein bedeutsamer Schritt vollzogen werden mit der Verabschiedung des Dokumentes „Ekklesiologische und kanonische Konsequenzen der sakramentalen Natur der Kirche. Kirchliche Communio, Konziliarität und Autorität“[17]. In diesem ökumenischen Text wird dargelegt, dass Primatialität und Synodalität in dem Sinne voneinander abhängig sind, dass der Primat immer im Kontext von Synodalität und dementsprechend die Synodalität im Kontext des Primats betrachtet werden müssen. Auf dieser theologischen Grundlage wird sodann gefordert, dass die Kirche auf allen Ebenen ihres Lebens und Wirkens und somit nicht nur auf der lokalen und regionalen, sondern auch auf der universalen Ebene einen Protos, einen Ersten braucht.
Die Tatsache, dass Katholiken und Orthodoxe zum ersten Mal gemeinsam erklären konnten, dass die Kirche auch auf der universalen Ebene einen Primat benötigt, stellt zweifellos einen ökumenischen Meilenstein dar. Auf dieser soliden Grundlage konnte – allerdings nach einer langen und schwierigen Phase – die grundsätzliche Fragestellung mit zwei weiteren Dokumenten über die geschichtlichen Entwicklungen konkretisiert werden. So wurde auf der Vollversammlung im Süditalienischen Chieti im Jahre 2016 ein Dokument mit dem Titel verabschiedet: „Synodalität und Primat im ersten Jahrtausend. Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis im Dienst an der Einheit der Kirche“[18]. Während in diesem Dokument das Verhältnis von Synodalität und Primat im Ersten, Ost und West gemeinsamen Jahrtausend dargestellt wird, hat die Vollversammlung im ägyptischen Alexandria im Jahre 2023 ein weiteres Dokument über die verschiedenen Entwicklungen im Zweiten Jahrtausend verabschiedet, das den Titel trägt: „Primat und Synodalität im Zweiten Jahrtausend und heute“.
b) Gleichgewicht zwischen Primat und Synodalität
In dieser Richtung muss der ökumenische Dialog über das Papstamt durch die Vertiefung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Synodalität und Primat mit ihrer gegenseitigen Interdependenz einen guten Weg in die Zukunft finden. Um bei dieser schwierigen Frage im katholisch-orthodoxen Dialog weiterkommen zu können, müssen auf beiden Seiten Schritte aufeinander zu im Sinne einer gegenseitigen Lernbereitschaft gemacht werden, wie sie der orthodox-katholische Arbeitskreis St. Irenäus in seiner Studie „Im Dienst an der Gemeinschaft“ in synthetischer Weise ausgesprochen hat: „Vor allem müssen die Kirchen danach streben, ein besseres Gleichgewicht zwischen Synodalität und Primat auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens zu erreichen, und zwar durch eine Stärkung synodaler Strukturen in der katholischen Kirche und durch die Akzeptanz eines gewissen Primats innerhalb der weltweiten Gemeinschaft der Kirchen in der orthodoxen Kirche.“[19]
Auf der einen Seite muss die Katholische Kirche eingestehen, dass sie in ihrem Leben und in ihren ekklesialen Strukturen noch nicht jenes Mass an Synodalität entwickelt hat, das theologisch möglich und notwendig wäre. Dies gilt zumal im Blick auf die regionale Ebene, die in den Orthodoxen Kirchen auf der Grundlage wichtiger Entscheidungen im Ersten Ökumenischen Konzil von Nicaea 325 und im Vierten Ökumenischen Konzil von Chalkedon 451 stark entwickelt sind. In der Katholischen Kirche hingegen besteht besonders auf der regionalen Ebene der Kirchenprovinzen, der Partikularkonzilien und der Bischofskonferenzen Nachholbedarf, wie auch Papst Franziskus feststellt: „Wir müssen nachdenken, um durch diese Organismen die Zwischeninstanzen der Kollegialität noch mehr zur Geltung zu bringen, eventuell durch Integration und Aktualisierung einiger Aspekte der alten Kirchenordnung.“[20]
Darin besteht eine wichtige Voraussetzung, um überzeugend dartun zu können, dass das primatiale und das synodale Prinzip sich einander nicht ausschliessen, sondern sich gegenseitig bedingen, wie der katholische Dogmatiker Medard Kehl die Identität der Katholischen Kirche umschrieben hat: „Die katholische Kirche versteht sich als das <Sakrament der Communio Gottes>; als solches bildet sie die vom Heiligen Geist geeinte, dem Sohn Jesus Christus zugestaltete und mit der ganzen Schöpfung zum Reich Gottes des Vaters berufene Gemeinschaft der Glaubenden, die synodal und <hierarchisch> zugleich verfasst ist.“[21] Eine überzeugende Realisierung dieses „zugleich“ und damit eine glaubwürdige Verbindung des primatial-hierarchischen mit dem synodal-communialen Prinzip wird deshalb eine wesentliche Hilfe der Katholischen Kirche für das weitere ökumenische Gespräch mit den Kirchen des Ostens über die Frage eines universalkirchlichen Einheitsdienstes sein, wie Kardinal Walter Kasper mit Recht betont: „Ohne Zweifel wäre Verstärkung der Synodalität der wichtigste ökumenische Beitrag der katholischen Kirche für die Anerkennung des Primats.“[22]
Auf der anderen Seite wird man von den Orthodoxen Kirchen erwarten dürfen, dass sie im ökumenischen Dialog lernen, dass ein Primat auch auf der universalen Ebene der Kirche nicht nur möglich und theologisch legitim, sondern auch notwendig ist, dass auch die innerorthodoxen Spannungen, die vor allem bei der „Heiligen und Grossen Synode“ von Kreta im Jahre 2016 deutlich zum Ausdruck gekommen sind[23], es nahelegen, über ein Amt der Einheit auch auf der universalen Ebene nachzudenken, das freilich mehr sein muss als ein reiner Ehrenprimat, sondern auch jurisdiktionelle Elemente einschliessen muss, und dass dies nicht im Gegensatz zur orthodoxen Ekklesiologie steht, sondern mit ihr kompatibel ist, wie der orthodoxe Metropolit John D. Zizioulas immer wieder in Erinnerung gerufen hat.[24]
Von den orthodoxen Kirchen ist deshalb auch zu erwarten, dass sie sich ihrem ekklesiologischen Kernproblem dezidiert stellen, nämlich der ekklesialen Struktur der Autokephalie von Nationalkirchen, die nicht selten starke Tendenzen zum Nationalistischen aufweisen. Dabei darf man dankbar feststellen, dass auch orthodoxe Theologen wie beispielsweise John Meyendorff die Konzeption von autokephalen Nationalkirchen als das eigentliche Problem innerhalb der Orthodoxie beurteilen und dessen theologische Aufarbeitung für vordringlich halten[25]. Darin dürfte der wichtigste Beitrag dafür liegen, dass der Weg für eine theologische Versöhnung zwischen der orthodoxen Ekklesiologie und dem Prinzip des petrinischen Dienstes frei werden kann.
Damit dürfte deutlich sein, dass die Frage des Primats des Bischofs von Rom nicht einfach als isolierte Einzelfrage behandelt werden kann, sondern im weiteren ekklesiologischen Problemkontext besprochen und vertieft werden muss. Konkret geht es dabei um die cruziale Frage nach dem Verhältnis zwischen Ortskirche und Universalkirche, hinsichtlich dessen ebenfalls wechselseitige Lernbereitschaft angezeigt ist: Während die katholische Tendenz zu einer einseitig universalistischen Ekklesiologie die Vielheit der Ortskirchen nicht in genügender Weise zu respektieren vermag, bleibt in der forcierten orthodoxen Ortskirchenekklesiologie die universale Dimension der Kirche weithin unterbelichtet. Ohne ein theologisch gesundes Gleichgewicht zwischen Universalkirche und Ortskirchen ist es aber kaum möglich, über ein Amt der Einheit auch auf der universalen Ebene in ökumenischer Gemeinschaft nachzudenken.
2. Das Papstamt in den Dialogen mit den reformatorischen Gemeinschaften
Diese Frage stellt sich in zugespitzter Weise in den ökumenischen Dialogen mit den aus den Reformationen hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Denn mit den Reformationen ist ein anderer Typus des Kircheseins wirksam geworden, der sich nicht nur vom spätmittelalterlichen ekklesialen Paradigma losgelöst, sondern sich auch von der ekklesialen Grundstruktur der Alten Kirche unterschieden hat. Die andere Weise, Kirche zu sein, besteht darin, nicht so zu sein, „wie es die Kirchen der grossen Tradition des Altertums sind, sondern aus einem neuen Verständnis heraus, wonach Kirche nicht in der Institution liegt, sondern in der Dynamik des Wortes, das die Menschen versammelt und zur Gemeinde macht“[26].
a) Ortsgemeinde und / oder Universalkirche?
Dieser neue Typus des Kircheseins ist am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vom evangelischen Kirchen- und Dogmenhistoriker Adolf von Harnack, freilich in zugespitzter Weise dahingehend formuliert worden: „Der Protestantismus muss rund bekennen, dass er eine Kirche wie die katholische nicht sein will und nicht sein kann, dass er alle formalen Autoritäten ablehnt, und dass er ausschliesslich auf den Eindruck rechnet, welchen die Botschaft von Gott und dem Vater Jesu Christi und unserem Vater hervorruft.“[27] Noch im Jahre 1962 konnte der Basler reformierte Theologe Karl Barth, der immerhin eine „Kirchliche Dogmatik“ verfasst hat, in seinen letzten Vorlesungen „Einführung in die evangelische Theologie“ urteilen: „Es ist gerade theologisch ratsam, das dunkle und belastete Wort <Kirche> wenn nicht gänzlich so doch tunlichst zu vermeiden, es jedenfalls sofort und konsequent durch das Wort <Gemeinde> zu interpretieren.“[28]
Das evangelische Kirchenverständnis hat somit seinen eindeutigen Schwerpunkt und gleichsam sein Gravitationszentrum in der konkreten Gemeinde am Ort. In evangelischer Sicht ist die Kirche Jesu Christi im vollen Sinn in der konkreten, um Wort und Sakrament versammelten Gottesdienstgemeinde gegeben. Die Gemeinde ist die prototypische Realisierung der Kirche. Die einzelnen Gemeinden stehen dabei durchaus miteinander im Austausch; insofern ist ein übergemeindlicher Aspekt präsent. Er bleibt jedoch theologisch unterbelichtet, was vollends für die universalkirchliche Dimension des Kircheseins gilt. So sind, um nur ein Beispiel zu nennen, die Lutherischen und Reformierten Weltbünde eben Bünde von Kirchen, aber nicht selbst Kirche, jedenfalls zumindest auf dem Weg vom Kirchenbund zur Kirchengemeinschaft.
Es ist erfreulich, dass die übergemeindliche und universalkirchliche Dimension des Kircheseins auch von Theologen in der reformatorischen Tradition immer deutlicher wiederentdeckt wird, und zwar unter direkter Bezugnahme auf die Feier der Eucharistie. Für den evangelischen Theologen Wolfhart Pannenberg impliziert die eucharistische Realität der Mitgegenwart der ganzen Christenheit in der Gegenwart Jesu Christi unter Brot und Wein in der Eucharistie notwendigerweise auch die Gesamtkirche. Denn in jeder Eucharistiefeier ist „mit dem wahren Leib des Herrn zugleich die ganze weltweite Kirche gegenwärtig, aber auch die Kirche aller früheren Generationen von Christen seit der Zeit der Apostel und der altkirchlichen Märtyrer.“[29] Auch der evangelische Theologe Gunther Wenz betont, dass jede Gottesdienstgemeinde ihrem Wesen nach „mit einem universalkirchlichen Bezug unveräusserlich verbunden ist“ und dass folglich die Kirche als congregatio sanctorum zugleich Gemeinschaft aller Gläubigen ist[30].
b) Theologisch notwendig oder allein pragmatisch möglich?
Es versteht sich von daher leicht, dass diese Theologen auch auf der Ebene der Gesamtkirche und in Bezug auf die ganze Christenheit einen Dienst an der Einheit der Christen im Apostolischen Glauben theologisch für notwendig erachten und von der Geschichte her die konkrete Realisierung eines solchen Einheitsdienstes im Bischof von Rom wahrnehmen[31]. Demgegenüber betrachten protestantische Theologen, die die universalkirchliche Dimension des Kircheseins weniger oder kaum gewichten, ein Papstamt als mit dem evangelischen Kirchenverständnis nicht vereinbar oder höchstens in der Gestalt eines repräsentativen Einheitsdienstes in pragmatischer Hinsicht und damit gemäss menschlichem Recht Sie zeigen damit den eigentlichen Grund auf, weshalb das evangelische Kirchenverständnis keine allgemein anerkannte Theologie des Bischofsamtes und erst recht keine Theologie eines universalkirchlichen Einheitsamtes kennt, wie die Katholische Kirche dieses im Petrusamt des Bischofs von Rom realisiert sieht. Wenn nämlich in der konkreten Einzelgemeinde die entscheidende Vollzugsgestalt von Kirche gesehen wird, dann stellt das Amt des pastor loci den Prototyp des kirchlichen Amtes dar. Pastoren- und Bischofsamt sind folglich theologisch identisch und nur funktional unterschieden: „Das Bischofsamt ist nach diesem Verständnis Pastorenamt in kirchenleitender Funktion.“[32]
Was das Papstamt betrifft, könnte ein solches aufgrund der Voraussetzungen des evangelischen Kirchenverständnisses deshalb nur unter pragmatischen, nicht jedoch unter kirchenkonstitutionellen Gesichtspunkten in Betracht gezogen werden, wie bereits der Reformator Philipp Melanchthon in seinem berühmt gewordenen Zusatz zu den Schmalkaldischen Artikeln betont hat, ein Papstamt könnte unter bestimmten Bedingungen nach „menschlichem Recht“ um des Friedens willen möglich - freilich nicht notwendig – sein.
Solange in den ökumenischen Dialogen über die Möglichkeit oder Notwendigkeit eines universalkirchlichen Einheitsdienstes noch kein Konsens besteht, muss sich das ökumenische Gespräch mit den aus den Reformationen hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften auf die angesprochenen ekklesiologischen Grundsatzfragen, vor allem auf die Klärung des Verhältnisses zwischen Ortskirchen und Universalkirche und überhaupt des Kirchenverständnisses konzentrieren. Diesbezüglich könnte freilich eine Rückbesinnung auf das Grundanliegen des Reformators Martin Luther weiterhelfen. Denn ihm ist es um eine umfassende Reform im Sinne der Erneuerung der ganzen Kirche gegangen und nicht um eine Reformation im Sinne der mit ihr schliesslich zerbrochenen Einheit der Kirche und des Entstehens von neuen reformatorischen Kirchen. Er hat deshalb auch, wie vor allem die ökumenische Gruppe von Farfa Sabina in ihrer Studie aufgezeigt hat, das Papsttum nicht einfach als solches abgelehnt, sondern die Möglichkeit seiner theologischen Bejahung von Bedingungen abhängig gemacht, „die alle letztlich darauf hinauslaufen, dass das Papstamt sich von seinen antichristlichen Zügen befreit und – summa summarum - <das Evangelium zulässt>“[33]. Selbst die scharfe Papstkritik Luthers hat sich, zumindest in den Anfängen seines Wirkens, nicht prinzipiell gegen das Papstamt als solches gerichtet, sondern gegen seine, wie Luther urteilte, missbräuchliche Ausübung.
Im Grunde hat Martin Luther damit die von Papst Johannes Paul II. vorgeschlagene Unterscheidung zwischen dem Wesen des Primats des Bischofs von Rom und der konkreten Form seiner Ausübung, freilich mit sehr polemischem Vorzeichen, vorweggenommen. Mit dieser grundsätzlichen Unterscheidung könnte der ökumenische Dialog über die Frage des Papstamtes auch mit den aus den Reformationen hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften weitergeführt werden.
III. Katholische Sicht einer ökumenischen Verständigung über das Papstamt
Im Sinne eines Ausblicks soll von daher noch eine kurze Perspektive in die Zukunft skizziert werden, wobei ich mich darauf konzentriere, was aus der Sicht der Katholischen Kirche, aber in ökumenischer Hinsicht in diese Dialoge einzubringen sein wird, weil es zum Wesen des Petrusdienstes elementar gehört. Dass damit auch Anfragen an die anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften verbunden sein müssen, die aber in ökumenischer Absicht gestellt werden, dürfte aus den bisherigen Darlegungen deutlich geworden sein.
Ein wesentliches ökumenisches Postulat besteht darin, dass der Primat des Bischofs von Rom dem Fundamentalprimat des Evangeliums nicht widersprechen darf, sondern ihm zu dienen hat. Bereits im Jahre 1972 hat der Malta-Bericht der Evangelisch-lutherisch / Römisch-katholischen Studienkommission „Das Evangelium und die Kirche“ das Amt des Papstes als „sichtbares Zeichen der Einheit der Kirchen“ nicht ausschliessen wollen, „soweit es durch theologische Reinterpretation und praktische Umstrukturierung dem Primat des Evangeliums untergeordnet wird“[34]. Diesem ökumenischen Postulat hat bereits das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Dogmatischen Konstitution über die Göttliche Offenbarung „Dei verbum“ mit der Überzeugung entsprochen, dass das kirchliche Lehramt nicht über dem Worte Gottes steht, sondern ihm zu Diensten ist.[35]
1. Dienst am Glauben der einen Kirche
Daraus folgt als erste Konsequenz, dass der petrinische Dienst an der Einheit der Kirche vor allem „Dienst am Glauben“ ist und sein muss und dass für diesen primatus fidei der Bischof von Rom der autorisierte Zeuge ist.[36] Wie zu jedem Amt in der Kirche gehört auch zum Papstamt der personale Zeugendienst, für den der Zeuge persönlich verantwortlich und haftbar ist. Da in der Kirche Autorität letztlich allein Jesus Christus als dem Haupt seines Leibes zukommt, kann menschliche und damit auch kirchliche Autorität nur in seinem Namen und als sein persönlich beauftragter Zeuge ausgeübt werden. Damit ist im Kern die bleibende Wahrheit zum Ausdruck gebracht, die die Katholische Kirche mit dem schwierigen und missverständlichen Wort der Unfehlbarkeit des Papstes bezeichnet.
Führt man sich diese martyrologische Dimension des Papstamtes vor Augen, kann dieses nicht nur im Sinne eines so genannten „Ehrenprimates“ verstanden und verwirklicht werden. Wenn man diesen Begriff beim Wort nimmt und damit im biblischen und altkirchlichen Sinn versteht, dann schliesst „Ehre“ immer auch Autorität mit ein, insofern man denjenigen, dem Ehre entgegengebracht wird, zu achten hat. Ein Blick in die Geschichte zeigt dabei, dass es während langer Zeit der Kaiser gewesen ist, dem solche Ehre zugekommen ist und der deshalb auch Konzilien einberufen und abgeschlossen hat. Heute gibt es den Kaiser nicht mehr, und er wird nur von sehr wenigen vermisst. Dann braucht es aber auch heute eine ähnliche Instanz, die über dieselben Kompetenzen verfügt. In diesem Sinn hat der katholische Dogmatiker Raymund Schwager im historischen Rückblick auf das erste Jahrtausend betont, wie „notwendig die Rolle der oströmischen Kaiser“ gewesen ist, „damit die Konzilien funktionieren konnten“; und er hat daraus den Schluss gezogen, dass in einer Ekklesiologie, die von der Wichtigkeit von Konzilien überzeugt ist, der petrinische „Vorsitz in der Liebe“ auch über jene Kompetenzen verfügen muss, „die die östlichen Kirchen des ersten Jahrtausends problemlos dem Kaiser zugestanden haben“: „Dem Bischof von Rom das zu geben, was man dem Kaiser lange Zeit und in zentralen Punkten zuerkannt hat, dürfte auch kein theologisches Problem sein.“[37] Zu diesen Kompetenzen könnten die Einberufung von Konzilien und die Möglichkeit, als Instanz zu Appellationen, zu dienen, gehören.
Zudem zeigt die Erfahrung, dass ein Dienst, der nicht auch Vollmachten besitzt, gerade in jenen Situationen, in denen man ihn am meisten braucht, wenig oder nichts hilft. Es kann deshalb nicht darum gehen, im Verständnis des Primats des Bischofs von Rom den Gesichtspunkt des Jurisdiktionellen überhaupt auszuschliessen. Es geht vielmehr darum, den Primat des Papstes in den Gesamtzusammenhang der Kirche zu reintegrieren, wie dies Hans Urs von Balthasar gefordert hat, dessen berühmtes Buch „Der antirömische Affekt“ sinnvollerweise den präzisierenden Untertitel trägt: „Wie lässt sich das Papsttum in der Gesamtkirche integrieren?“[38]
Die beste Integration in der Gesamtkirche auch und gerade in ökumenischer Sicht besteht darin, dass der Primat des Bischofs von Rom als ein Primat des Gehorsams gegenüber dem Evangelium zu verstehen ist, wie dies die Römische Kongregation für die Glaubenslehre im Jahre 1998 und damit unter dem Vorsitz des damaligen Kardinals Joseph Ratzinger in ihren theologischen „Erwägungen zum Primat des Nachfolgers Petri im Geheimnis der Kirche“ ausgesprochen hat: „Der römische Bischof steht – wie alle Gläubigen – unter dem Worte Gottes und unter dem katholischen Glauben. Er ist Garant für den Gehorsam der Kirche und in diesem Sinn servus servorum. Er entscheidet nicht nach eigener Willkür, sondern ist Stimme für den Willen des Herrn, der zum Menschen in der von der Überlieferung gelebten und interpretierten Schrift spricht. Mit anderen Worten: Die episkope des Primats hat die Grenzen, die aus dem Gesetz Gottes und der in der Offenbarung enthaltenen, unantastbaren göttlichen Stiftung der Kirche hervorgehen.“[39]
Der Bischof von Rom, dessen primatiale Aufgabe darin besteht, die Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Worte Gottes zu verpflichten, ist berufen, sich selbst als der exemplarisch Gehorsame zu erweisen. Er kann sich deshalb nicht im Sinne einer Monarchie politischer Art als absoluter Herrscher verstehen, der sich nur nach seinem Willen richten würde; er kann aber seinen Dienst auch nicht auf einen blossen Ehrenvorrang beschränken. Sein Primat ist vielmehr letztverbindlicher Dienst am Glauben und glaubwürdiger Dienst an der Liebe und so Dienst an der Einheit der Kirche und auch Dienst an der Einheit der Christen.
In diesem Sinn hat Papst Franziskus während seines Besuchs beim Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. in Konstantinopel im Jahre 2014 versichert, „dass die katholische Kirche, um das ersehnte Ziel der vollen Einheit zu erreichen, nicht beabsichtigt, irgendeine Forderung aufzuerlegen als die, den gemeinsamen Glauben zu bekennen, und dass wir bereit sind, im Licht der Lehre der Schrift und der Erfahrung des ersten Jahrtausends gemeinsam die Bedingungen zu suchen, um mit diesen die notwendige Einheit der Kirche unter den gegenwärtigen Umständen zu gewährleisten: Das Einzige, was die katholische Kirche wünscht und ich als Bischof von Rom, <der Kirche, die den Vorsitz in der Liebe führt>, anstrebe, ist die Gemeinschaft mit den Orthodoxen Kirchen.“[40] Ein analoges Ziel gilt selbstredend auch im Blick auf die reformatorischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Diese Sicht entspricht der ökumenischen Grundüberzeugung, dass es am Glauben vorbei keine Einheit der Kirche geben kann. Die Einheit der Kirche gründet vielmehr im Apostolischen Glauben, der jedem neuen Glied am Leibe Christi in der Taufe übergeben und anvertraut wird.
2. Dienst an der eucharistischen Liebe
Von daher öffnet sich der Blick auf eine weitere wichtige Wesensbestimmung des petrinischen Primates in katholischer Sicht, die ebenfalls ökumenischen Konsens finden könnte. Auszugehen ist dabei von der geschichtlichen Beobachtung, dass bereits der heilige Ignatius von Antiochien in seinem Brief an die Römer im Jahre 110 die Kirche der Kathedra des Bischofs von Rom jene Kirche genannt hat, die den „Vorsitz in der Liebe“ hat. Mit dem Wort „Liebe“ – „agape“ – ist in der frühen Kirche auch und besonders das Geheimnis der Eucharistie bezeichnet worden, in der die Liebe Jesu Christi zu seiner Kirche besonders intensiv erfahren wird. Von daher kommt eine enge Zusammengehörigkeit von Petrusdienst und Eucharistie an den Tag. Sie impliziert, dass der Primat des Bischofs von Rom nicht allein als eine juridische und schon gar nicht als eine rein äusserliche Zutat zu einer eucharistischen Ekklesiologie zu verstehen, sondern in ihr selbst begründet ist. Denn die Kirche, die sich als weltweites Netz von eucharistischen Gemeinschaften versteht, braucht auch auf der universalen Ebene einen vollmächtigen Dienst an der Einheit; und der Primat des Bischofs von Rom ist letztlich nur von diesem weltweiten eucharistischen Netz her zu verstehen.[41] Der Bischof von Rom nimmt deshalb seine besondere Verantwortung dadurch wahr, dass er den „Vorsitz in der Liebe“ lebt und in der Eucharistie alle Ortskirchen auf der ganzen Welt zur universalen Kirche verbindet und damit Kirche als communio ecclesiarum und communio ecclesiae erfahrbar werden lässt. Damit wird nochmals deutlich, dass im Licht dieses Verständnisses des petrinischen Dienstes eine eucharistisch bestimmte und eine universale Ekklesiologie sich nicht gegenseitig ausschliessen, sondern sich vielmehr gegenseitig fordern und fördern.
Wie Papst Benedikt XVI. immer wieder, und zwar gerade in ökumenischer Hinsicht, betont hat[42], ist der Dienst des Bischofs von Rom als Primat der Liebe im eucharistischen Sinn zu verstehen, indem er in der Kirche um eine Einheit besorgt ist, die eucharistische Gemeinschaft ermöglicht und schützt und glaubwürdig und wirksam verhindert, dass ein eucharistischer Altar gegen einen anderen Altar gestellt wird, wie dies beispielsweise in der Auseinandersetzung des Optatus von Mileve mit den Donatisten in eklatanter Weise der Fall gewesen ist[43]. In diesem grundlegenden Sinn erweist sich der Primat des Bischofs von Rom, der im Dienst der eucharistischen Einheit der Kirche steht und dafür Sorge trägt, dass die Kirche immer wieder von der Eucharistie her Mass nimmt, als ein bleibendes Wesenselement der Kirche in katholischer Sicht.
Vom Verständnis des petrinischen Dienstes an der Eucharistie her könnte sich auch ein neuer Zugang zu einem ökumenischen Verständnis des Petrusamtes eröffnen, zumal wenn wir bedenken, dass das orthodoxe Kirchenverständnis eine konsequent eucharistische Ekklesiologie ist und dass auch der reformatorischen Konzentration des Kirchenverständnisses auf die Gemeinde im Wesentlichen eine gottesdienstliche Ekklesiologie zugrunde liegt. Damit ist auch das eigentliche Ziel allen ökumenischen Bemühens anvisiert, das in der Wiederherstellung der Einheit der Kirche und in der Folge der eucharistischen Gemeinschaft besteht, wie dies der Ökumenische Patriarch Athenagoras bereits im Jahre 1968 in einem Telegramm an Papst Paul VI. mit diesen dichten Worten ausgesprochen hat: «Die Stunde des christlichen Mutes ist gekommen. Wir lieben einander; wir bekennen den gleichen gemeinsamen Glauben; machen wir uns zusammen auf den Weg vor die Herrlichkeit des gemeinsamen heiligen Altars, um den Willen des Herrn zu erfüllen, damit die Kirche strahlt, damit die Welt glaubt und der Friede Gottes auf alle kommt.»[44]
Wird der Petrusdienst des Bischofs von Rom von der Eucharistie her verstanden, dürfte abschliessend auch verstehbar werden, dass sein Vorsitz in der Liebe und sein Vorsitz in der Lehre des Glaubens unlösbar zusammengehören. Auf der einen Seite gründet die Liebe, der der Bischof von Rom in besonderer Weise zu dienen hat, im Glauben. Denn der Vorsitz in der Liebe besteht in erster Linie in der Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber dem Wort und Willen Gottes und ist als Dienst am Glaubensgehorsam zu verstehen. Auf der anderen Seite ist der Vorsitz im Glauben an den Vorsitz in der Liebe gebunden. Der Vorsitz des Bischofs von Rom im Glauben muss Vorsitz in der Liebe sein. Denn die Lehre der Kirche vermag die Menschen nur zu erreichen, wenn sie zur Liebe führt.
Wenn darüber ökumenischer Konsens erreicht werden könnte, dass dem Bischof von Rom der Dienst am Glauben und der Dienst an der Liebe in besonderer Weise anvertraut sind, müsste das Papstamt nicht weiterhin als das schwerwiegendste Hindernis auf dem ökumenischen Weg beurteilt werden, sondern könnte als Garant der Einheit der Kirche und als Promotor der ökumenischen Verständigung wertgeschätzt werden. Und dann würde auch verstehbar, weshalb die Katholische Kirche das Petrusamt als ein grosses Geschenk betrachtet, das sie von Christus erhalten hat, jedoch nicht für sich behalten darf, sondern das sie mit der ganzen Christenheit in ökumenischer Gemeinschaft teilen möchte.
[1] Dokumentiert in: AAS 59 (1967) 498.
[2] Johannes Paul II., Ut unum sint, Nr. 88.
[3] Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten (Hamburg 1994) 181.
[4] Johannes Paul II., Ut unum sint, Nr. 95.
[5] Benedikt XVI., Ansprache bei der Begegnung mit Vertretern der Orthodoxen Kirchen in Freiburg i. Br. am 24. September 2011.
[6] Benedikt XVI., Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald (Freiburg i. Br. 2010). 114.
[7] J. Kardinal Ratzinger, Die ökumenische Situation – Orthodoxie, Katholizismus und Reformation, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre (München 1982) 203-214, zit. 209.
[8] Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 32.
[9] Franziskus, Ansprache bei der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode am 17. Oktober 2015.
[10] Franziskus, Ansprache an die ökumenische Delegation des Patriarchats von Konstantinopel am 27. Juni 2015.
[11] Briefwechsel zwischen Metropolit Damaskinos und Joseph Cardinal Ratzinger, in: J. Cardinal Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio (Augsburg 2002) 187-209, zit. 203.
[12] Vgl. The Bishop of Rome. Primacy and Synodality in the Ecumenical Dialogues and in the Responses to the Encyclical Ut unum sint. A Study Document of the Dicastery for Promoting Christian Unity = Collana UT UNUM SINT 7 (Città del Vaticano 2024).
[13] Unitatis redintegratio, Nr. 13.
[14] W. Kasper, Der Bischof von Rom als Diener der Einheit, in: Ders., Einheit in Jesus Christus. Schriften zur Ökumene II = Gesammelte Schriften. Band 15 (Freiburg i. Br. 2013) 268-287, zit. 276.
[15] Vgl. Kardinal K. Koch, Ökumenische Aspekte der Frage nach dem Priestertum, in: Kardinal M. Ouellet (Hrsg.), Für eine Fundamentaltheologie des Priestertums. Beiträge des Internationalen Symposiums Band 1 (Freiburg i. Br. 2023) 199-214.
[16] Benedikt XVI., Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald (Freiburg i. Br. 2010) 114.
[17] Dokumentiert in: J. Oeldemann / F. Nüssel / U. Swarat / A. Vletsis (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte Interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene. Band 4: 2001-2010 (Paderborn – Leipzig 2012) 833-848.
[18] Dokumentiert in: J. Oeldemann / F. Nüssel / U. Swarat / A. Vletsis (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 5: 2011-2019 (Paderborn – Leipzig 2021) 1006-1014.
[19] Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken. Eine Studie des Gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreises St. Irenäus (Paderborn 2018) 94.
[20] Franziskus, Ansprache bei der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode am 17. Oktober 2015.
[21] M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie (Würzburg 1992) 51.
[22] W. Kasper, Petrusdienst und Petrusamt. Biblische Grundlagen – Geschichtliche Entwicklung – Ökumenische Perspektiven, in: Ders., Die Kirche und ihre Ämter = Gesammelte Schriften. Band 12 (Freiburg i. Br. 2009) 569-652, zit. 647.
[23] Vgl. Th. Hainthaler, Nach der “Heiligen und Grossen Synode” von Kreta 2016. Fragen und Überlegungen zu einem Neuansatz des orthodox-katholischen Dialogs, in: D. Schon (Hrsg.), Dialog 2.0 – Braucht der orthodox-katholische Dialog neue Impulse? = Schriften des Ostkircheninstituts der Diözese Regensburg. Band 1 (Regensburg 2017) 118-133.
[24] J. D. Zizioulas, Being as Communion (New York 1985); Idem, The One and the Many. Studies on God, Man, the Church and the World Today (Alhambra 2010).
[25] J. Meyendorff, Orthodoxy and Catholicity (New York 1966); Ders., The Byzantine Legacy in the Orthodox Church (New York 1982).
[26] Benedikt XVI., Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald (Freiburg i. Br. 2010) 120.
[27] Briefwechsel von Adolf von Harnack und ein Epilog, in: E. Peterson, Theologische Traktate = Ausgewählte Schriften I (Würzburg 1994) 175-194, zit. 182.
[28] K. Barth, Einführung in die evangelische Theologie (Zürich 1962) 35.
[29] W. Pannenberg, Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, in: Ders., Beiträge zur Systematischen Theologie. Band 3: Kirche und Ökumene (Göttingen 2000) 11-22, zit. 15.
[30] G. Wenz, Communio Ecclesiarum, in: F. W. Graf / D. Korsch, Jenseits der Einheit. Protestantische Ansichten der Ökumene (Hannover 2001) 111-124, zit. 113.
[31] Vgl. W. Pannenberg, Evangelische Überlegungen zum Petrusdienst des römischen Bischofs, in: Ders., Beiträge zur Systematischen Theologie. Band 3: Kirche und Ökumene (Göttingen 2000) 366-377; G. Wenz, Das Petrusamt aus lutherischer Sicht, in: S. Hell / L. Lies (Hrsg.), Papstamt. Hoffnung. Chance, Ärgernis. Ökumenische Diskussion in einer globalisierten Welt (Innsbruck 2000) 67-95.
[32] W. Kardinal Kasper, Perspektiven einer sich wandelnden Ökumene. Das ökumenische Engagement der katholischen Kirche, in: Stimmen der Zeit 110 (2202) 651-661, zit. 659.
[33] Gruppe von Farfa Sabina, Gemeinschaft der Kirchen und Petrusamt. Lutherisch-katholische Annäherungen (Frankfurt a. M. 2010) 41-42.
[34] Malta-Bericht, Nr. 66, zit. in: H. Meyer / H. J. Urban / L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene 1931-1982 (Paderborn – Frankfurt a. M. 1983) 248-271, zit. 266.
[35] Dei verbum, Nr. 10.
[36] W. Kasper, Dienst an der Einheit und Freiheit der Kirche,. Zur gegenwärtigen Diskussion um das Petrusamt in der Kirche, in: Ders., Einheit in Jesus Christus. Schriften zur Ökumene II = Gesammelte Schriften. Band 15 (Freiburg i. Br. 2013) 241-267, bes. 259-267.
[37] R. Schwager, Papstamt und gesellschaftliche Bedingungen, in: S. Hell / L. Lies (Hrsg.), Papstamt. Hoffnung. Chance, Ärgernis. Ökumenische Diskussion in einer globalisierten Welt (Innsbruck 2000) 271-272.
[38] H. U. von Balthasar, Der antirömische Affekt. Wie lässt sich das Papsttum in der Gesamtkirche integrieren? (Freiburg i. Br. 1974).
[39] Kongregation für die Glaubenslehre, Erwägungen zum Primat des Nachfolgers Petri im Geheimnis der Kirche, in: Dies., Dokumente seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Erweiterte Ausgabe (1966-2013) (Freiburg i. Br. 2015) 566-575, zit. 571, Nr. 7
[40] Franziskus, Ansprache in der Patriarchatskirche St. Georg, Istanbul am 30. November 2014.
[41] Vgl. B. Forte, Il primato nell‘eucaristia. Considerazioni ecumeniche intorno al ministero petrino nella Chiesa, in: Asprenas 23 (1976) 391-410.
[42] Vgl. K. Cardinal Koch, Vorsitz in der Liebe und in der Glaubenslehre. Das Papstamt in der Sicht von Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., in: Ders., Die Taubheit gegenüber Gott überwinden. Zur bleibenden Aktualität der Theologie von Papst Benedikt XVI. (Heiligenkreuz im Wienerwald 2023) 85-110.
[43] Vgl. J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche (St. Ottilien 1992), bes 102-123: Optatus von Mileve.
[44] Télégramme du patriarche Athénagoras au pape Paul VI, à l’occasion de l’anniversaire de la levée des anathèmes le 7 décembre 1969, dans:Tomos Agapis. Vatican-Phanar (1958-1970) (Rome – Istanbul 1971) Nr. 277.