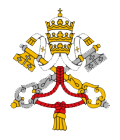WAS UNSERE WEITEN ORTSKIRCHEN UNAUFGEBBAR BRAUCHEN
Hilfen aus der Praxis der weltweiten Ökumene
Vortrag bei der 50. Theologischen Studienwoche für Priester, Ordensleute und Laienmitarbeiter der Katholischen Kirche in Nordeuropa in Ohrbeck bei Osnabrück am 26. Juni 2024
1. Ökumenischer „Austausch der Gaben“
Beim Bedenken der Sendung der Kirche in die Welt von morgen fragen Sie auch danach, was wir in der Kirche, zumal in den Ortskirchen im Norden Europas, unaufgebbar nötig haben, und Sie erwarten dabei auch Wegweisungen aus der weltweiten Ökumene. Diesbezüglich stellt sich zunächst die Frage, was unter Ökumene genauer zu verstehen ist und wie sie vollzogen wird. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird der dialogische Weg zur Verständigung unter den Christen und kirchlichen Gemeinschaften als „Austausch der Gaben“ bezeichnet. Dahinter steht die Überzeugung, dass jede christliche Kirche und kirchliche Gemeinschaft besondere Gaben erhalten hat. Denn keine Kirche ist so arm, dass sie nicht einen eigenen Beitrag in das grössere Ganze der christlichen Gemeinschaft einbringen könnte. Keine Kirche ist aber auch so reich, dass sie nicht der Bereicherung durch die Gaben anderer Kirchen bedürfte.
Unter Ökumene ist nicht einfach ein Austausch von Ideen und Gedanken zu verstehen, sondern ein wirklicher „Austausch der Gaben“. Diese Aufgabe haben die Päpste seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil stets wach gehalten und vollzogen. Papst Johannes Paul II. ist der erste Papst gewesen, der eine Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene verfasst und darin einen ganzen Abschnitt den „Früchten des Dialogs“ gewidmet hat.[1] Auf die Frage, warum der Heilige Geist in der Geschichte der Kirche so viele Spaltungen zugelassen habe, hat Papst Johannes Paul II. zwei Antworten gegeben, eine negative und eine positive. Die negative Antwort erblickt im Auseinanderbrechen der Einheit der Kirche „die bittere Frucht der Sünden der Christen“. Demgegenüber vertraut die positive Antwort auf den Heiligen Geist, „der das Gute sogar dem Bösen, den menschlichen Schwächen abzugewinnen vermag“. In diesem Zusammenhang stellt sich Papst Johannes Paul II. sogar die herausfordernde Frage: „Könnte es nicht auch so sein, dass diese Auseinanderentwicklungen ein Weg waren und sind, um die Kirche die vielfältigen Reichtümer entdecken zu lassen, die im Evangelium Christi und in der von Christus bewirkten Erlösung enthalten sind? Vielleicht hätten diese Reichtümer anders nicht ans Licht gelangen können…“[2]
In dieselbe Zielrichtung hat auch Papst Benedikt XVI. gedacht. Ausgehend von dem gewiss geheimnisvollen Wort des Apostels Paulus im Ersten Brief an die Korinther, dass Spaltungen „sein müssen“ (1 Kor 11, 19), sieht Papst Benedikt XVI. in den historischen Spaltungen in der Kirche nicht nur menschliche Sünde am Werk, sondern nimmt auch eine Dimension wahr, „die einem göttlichen Verfügen entspricht“. So fragt er konkret, ob es für die katholische Kirche in Deutschland und darüber hinaus nicht in vieler Hinsicht gut gewesen sei, dass es „neben ihr den Protestantismus mit seiner Liberalität und seiner Frömmigkeit, mit seinen Zerrissenheiten und mit seinem hohen geistigen Anspruch gegeben hat? Gewiss, in den Zeiten des Glaubenskampfes war Spaltung fast nur gegeneinander; aber immer mehr ist dann auch Positives für den Glauben auf beiden Seiten gewachsen, das uns etwas von dem geheimnisvollen <Muss> des heiligen Paulus verstehen lässt.“ Papst Benedikt XVI. fragt aber auch umgekehrt: „Könnte man sich eigentlich eine nur protestantische Welt denken? Oder ist der Protestantismus in all seinen Aussagen gerade als Protest nicht so vollständig auf den Katholizismus bezogen, dass er ohne ihn kaum noch vorstellbar bliebe?“ Aus diesen Fragen zieht er schliesslich die Konsequenz, dass man in der Ökumene versuchen sollte, „durch Verschiedenheit Einheit zu finden, das heisst: in den Spaltungen das Fruchtbare anzunehmen, sie zu entgiften und gerade von der Verschiedenheit Positives zu empfangen – natürlich in der Hoffnung, dass am Ende die Spaltung überhaupt aufhört, Spaltung zu sein und nur noch <Polarität> ohne Widerspruch ist.“[3]
Auch Papst Franziskus bezieht sich immer wieder auf das Wort des „Austausches der Gaben“, bei dem es sich nicht einfach um eine „rein theoretische Übung“ handeln kann, der es vielmehr ermöglicht, „die gegenseitigen Traditionen in der Tiefe zu kennen, um sie zu verstehen und zuweilen auch aus ihnen zu lernen“[4]. Denn in den ökumenischen Dialogen gehe es nicht nur darum, „Informationen über die anderen zu erhalten, um sie besser kennen zu lernen“; es gehe vielmehr darum, „das, was der Geist bei ihnen gesät hat, als ein Geschenk aufzunehmen, das auch für uns bestimmt ist“. Als anschauliches Beispiel nennt er dabei den Dialog mit den orthodoxen Brüdern, bei denen wir Katholiken die Möglichkeit haben, „etwas mehr über die Bedeutung der bischöflichen Kollegialität und über ihre Erfahrung der Synodalität zu lernen“[5].
2. Zwei Jubiläen als ökumenische Herausforderungen
Von der weltweiten Ökumene Wegweisungen für die Sendung der Kirche heute und morgen zu erhalten, bedeutet somit, im „Austausch der Gaben“ gegenseitig aneinander Anteil an den eigenen Gaben zu geben und ebenso gegenseitig voneinander zu lernen. Was dies konkret bedeutet, will ich zunächst an zwei bedeutenden Jubiläen verdeutlichen, die uns bevorstehen und die für die ökumenische Gemeinschaft von grundlegender Bedeutung sind.
a) 1700 Jahre Konzil von Nicaea und das gemeinsame Christusbekenntnis
Im Jahre 2025 wird die gesamte Christenheit den 1700. Jahrestag des Ersten Ökumenischen Konzils in der Geschichte der Kirche begehen, das im Jahre 325 in Nicaea stattgefunden hat.[6] Im damals heftig geführten Streit um das rechte Christusbekenntnis hat vor allem der alexandrinische Theologe Arius einen strengen Monotheismus im Sinne des damaligen philosophischen Denkens vertreten, demgemäss Christus nicht im eigentlichen Sinn „Sohn Gottes“ sein könne, sondern nur ein Mittelwesen, dessen sich Gott in seinen Beziehungen zu den Menschen bediene. Diese Position hat das Konzil von Nicaea mit dem Glaubensbekenntnis zurückgewiesen, dass Jesus Christus wahrhaft der Sohn Gottes und als solcher „wesensgleich mit dem Vater“ ist. Dieses Bekenntnis ist zur Grundlage des gemeinsamen christlichen Glaubens geworden.
Dieses Konzil hat zu einer Zeit stattgefunden, in der die Christenheit noch nicht von den vielen späteren Spaltungen verwundet gewesen ist. Das Bekenntnis von Nicaea verbindet deshalb auch heute alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften und ist in seiner ökumenischen Bedeutung nicht zu unterschätzen. Das 1700-Jahr-Jubiläum ist von daher eine günstige Gelegenheit, dieses Konzils in ökumenischer Gemeinschaft zu gedenken und sich seines christologischen Bekenntnisses erneut zu vergewissern, in dem die Einheit im Glauben begründet ist. Denn für die ökumenische Wiedergewinnung der Einheit der Kirche ist die Übereinstimmung im wesentlichen Inhalt des Glaubens erforderlich, und zwar nicht nur zwischen den in der Gegenwart lebenden Kirchen, sondern auch die Übereinstimmung mit der Kirche der Vergangenheit und vor allem mit ihrem apostolischen Ursprung.
Die Wegweisung, die sich aus diesem Konzilsjubiläum ergibt, besteht in einer erneuten Konzentration auf das Christusbekenntnis und die ihm zugrundeliegende Gottesfrage.[7] Diese Wegweisung hat neue Aktualität gewonnen in der heutigen Zeit, die sich nicht durch eine intensive Gottsuche auszeichnet, sondern eher durch eine dumpfe Taubheit gegenüber Gott. In der heutigen Gesellschaft wird Gott stets weniger als gegenwärtig wahrgenommen. Er wird vielmehr oft auf die Ersatzbank gesetzt oder aus dem gesellschaftlichen Leben an den Rand gedrängt. Das Leben nicht weniger Menschen zeichnet sich durch eine weitgehende Gottvergessenheit aus, und zwar bis dahin, dass sie sogar vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben.
Selbst im Bereich von Kirche und Ökumene ist oft eine Schwerhörigkeit gegenüber Gott festzustellen. Die eigentliche Glaubenskrise liegt heute in einem weitgehenden Verblassen des biblisch-christlichen Bildes Gottes als eines in der Geschichte gegenwärtigen und handelnden Gottes. Dieses grundlegende Problem lässt sich in der Kurzformel festmachen: „Religion ja – ein persönlicher Gott nein“. Die Krise des Gottesglaubens ist auch deshalb nicht leicht zu diagnostizieren, weil sie in einer an sich religionsfreundlichen Atmosphäre stattfindet. Mit ihr kommt jedoch zum Ausdruck, dass sich immer mehr auch Christen einen Gott nicht mehr vorstellen können, der in unserer Welt als gegenwärtig wahrgenommen wird, der in ihr handelt und der sich um den einzelnen Menschen sorgt. Gott mag, wenn es ihn denn geben sollte, den Urknall angestossen haben; mehr jedoch bleibt ihm nicht in der aufgeklärten Welt von heute. Es scheint, dass sich der seit der europäischen Aufklärung aufgekommene Deismus im allgemeinen Bewusstsein durchgesetzt und auch in den Kirchen Eingang gefunden hat.
Ein so verstandener Gott ist freilich weder zum Fürchten noch zum Lieben. Es fehlt die Leidenschaft für Gott. Darin dürfte die tiefste Glaubensnot in der heutigen Zeit liegen, die zudem Konsequenzen für das Christusbekenntnis hat. Denn Christen glauben nicht einfach an irgendeinen Gott im Sinne eines höchsten Wesens jenseits der Welt. Sie bekennen sich vielmehr zu einem Gott, der mit uns Menschen in Beziehung stehen und für uns da sein will, der deshalb nicht stumm ist, sondern spricht, der zu seinem Volk Israel gesprochen hat und sich in endgültiger Weise in seinem Sohn Jesus von Nazareth mitgeteilt und sein wahres Gesicht gezeigt hat. Zum christlichen Grundzeugnis für den lebendigen Gott gehört deshalb auch zentral das Zeugnis für Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist.
Gewiss lassen sich auch heute viele Menschen und selbst Christen von allen menschlichen Dimensionen an Jesus von Nazareth durchaus berühren; das Bekenntnis, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist, der als der Auferweckte in der Person des Heiligen Geistes unter uns gegenwärtig ist, und insofern der kirchliche Christusglaube bereitet heute jedoch vielen Mühe. Selbst in den Kirchen will es heute oft nicht mehr gelingen, im Menschen Jesus das Antlitz des Sohnes Gottes wahrzunehmen und in ihm nicht einfach einen – wenn auch hervorragenden und besonders guten – Menschen zu sehen. Die Krise des Christusglaubens lässt sich deshalb am ehesten in der Formel ausdrücken: „Jesus ja – Sohn Gottes nein“. Dies bedeutet, dass der Arianismus nicht einfach der Vergangenheit angehört, sondern auch heute wirksam ist. Mit dem Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, steht oder fällt aber der christliche Glaube. Jesus Christus in seiner ganzen Grösse wieder neu sehen zu lernen und den Christusglauben zu erneuern, ist deshalb das dringende Gebot im Jubiläumsjahr des Konzils von Nizaea.
Diese Wegweisung hat bereits Papst Benedikt XVI. in Erfurt im Jahre 2011 der ganzen Ökumene ans Herz gelegt. Bei seinem Besuch im ehemaligen Augustinerkloster, wo Martin Luther Theologie studiert hat und zum Priester geweiht worden ist. hat Papst Benedikt XVI. auf den Reformator Bezug genommen und in seinem Leben und Wirken seine leidenschaftliche Gottsuche hervorgehoben: „Was ihn umtrieb, war die Frage nach Gott, die die tiefe Leidenschaft seines Lebens und seines ganzen Weges gewesen ist.“[8] Zugleich hat der Papst betont, dass Luther nicht irgendeinen Gott gesucht, sondern an jenen Gott geglaubt hat, der uns sein konkretes Gesicht im Menschen Jesus von Nazareth gezeigt hat, und dass er deshalb seine leidenschaftliche Gottsuche in der Christozentrik seiner Spiritualität und Theologie vertieft hat.
Aus dieser Betonung der Zentralität der Gottesfrage und der Christozentrik hat Benedikt XVI. die wichtige Wegweisung für die Ökumene abgeleitet: „Unser erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit muss es sein, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen und damit der Welt die Antwort zu geben, die sie braucht.“ Und dazu gehört auch zentral das „Zeugnis für Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott“[9]. In der Tat muss in der heutigen Zeit die allererste Priorität darin bestehen, den Menschen den Zugang zu Gott wieder zu öffnen, und zwar nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, dessen Gesicht wir in Jesus Christus erkennen dürfen. Dieses Glaubensbekenntnis brauchen wir heute unabdingbar.
b) 500 Jahre Confessio Augustana und die Botschaft von der Gnade
Im Jahre 2030 wird der 500. Jahrestag des Augsburger Reichstages und der Übergabe des Augsburger Bekenntnisses an Kaiser Karl V. am 25. Juni 1530 gefeiert werden.[10] Die evangelischen Fürsten und Reichsstädte haben damals die Übergabe mit der Intention vollzogen, dass dieses Bekenntnis den katholischen Glauben bezeugen will, wie beim Abschluss des Ersten Teils ausdrücklich festgehalten wird: „dass nichts darin vorhanden ist, was abweicht von der Heiligen Schrift und von der allgemeinen und von der römischen Kirche, wie wir sie aus den Kirchenschriftstellern kennen“. Das intendierte Ziel der Bewahrung der Einheit konnte damals tragischerweise nicht erreicht werden. Aus diesem Grund ist die Confessio Augustana später die grundlegende Bekenntnisschrift der Lutheraner geworden. Im Ursprung ist sie aber kein Dokument der Spaltung, sondern des entschiedenen Willens zur Versöhnung und zur Bewahrung der Einheit gewesen. Der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen hat deshalb mit Recht geurteilt: „Möglicherweise waren die Kirchen der abendländischen Christenheit in der Tat beim Reichstag zu Augsburg 1530 einander so nahe wie später nie wieder.“[11] Der ursprünglichen Intention der Confessio Augustana wird man von daher nur gerecht, wenn man sie als vorkonfessionelles Bekenntnis würdigt und für die heutige ökumenische Situation fruchtbar macht. Wenn man diese ökumenische Bedeutung bedenkt, kann man nur hoffen, dass der 500. Gedenktag des Reichstags zu Augsburg und der damals verkündeten Confessio Augustana ihrer ursprünglichen Intention gemäss in ökumenischer Gemeinschaft begangen werden und ein erneuerter Impuls sein wird, die in der Reformationszeit verlorene Einheit der Kirche wieder zu suchen und zu finden.
(1) Anthropologische Wohltat des Rechtfertigungsglaubens
Im Mittelpunkt der damaligen Auseinandersetzungen hat die unterschiedliche Interpretation der biblischen Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders durch Gottes Gnade im Glauben gestanden. Diese Glaubenslehre ist zu einem der Hauptgründe für die Spaltung in der Kirche im Abendland im 16. Jahrhundert geworden. Mit der Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ durch den Lutherischen Weltbund und den Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen am 31. Oktober 1999 in Augsburg konnte jedoch ein weitgehender Konsens über Grundfragen dieser Lehre erzielt werden. Die Tatsache, dass jene Glaubenslehre, die im Reformationszeitalter zur Kirchenspaltung geführt hat, heute weitgehend in ökumenischer Gemeinschaft bezeugt werden kann, darf als wichtiger Meilenstein im Dialog zwischen Katholiken und Lutheranern und in der Ökumenischen Bewegung überhaupt gewürdigt werden.[12]
Die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen im Glauben an Gott und die ihr zugrundeliegende Botschaft von der Gnade Gottes haben in der heutigen Zeit nichts an Aktualität eingebüsst, sondern gehören mit zu jenen Glaubensüberzeugungen, deren Verkündigung wir zumal in der heutigen Kirche und Welt unaufgebbar brauchen. Denn das Wort von der Gnade im Sinne der liebenden Zuwendung Gottes zu uns Menschen impliziert den Primat des Empfangens vor dem Tun, des Beschenkt-Seins vor den eigenen Leistungen. Damit wird die humane Wohltat der Glaubenslehre von der Gnade Gottes sichtbar, die darin besteht, dass sie im Menschsein des Menschen zwischen seinem Person-Sein und seinem Täter-Sein grundlegend unterscheidet. Vor allem Tätigwerden des Menschen nimmt die Botschaft von der Gnade Gottes den Menschen als eine von ihren Taten grundsätzlich unterscheidbare Person ernst, die menschliche Person gerade nicht dadurch wird, dass sie tätig ist, sondern dass sie sich selbst von Gott empfängt und sich ihm verdankt. Zum Täter wird der Mensch demgegenüber in der Liebe, die aus dem Glauben folgt. Daraus ergibt sich in soteriologischer Hinsicht die zweifellos elementarste Konsequenz, dass der Mensch unendlich mehr ist als die Bilanz seiner Taten und erst recht als die Bilanz seiner Untaten. Die Leistung ist durchaus das Recht des Menschen, auf keinen Fall aber seine Rechtfertigung. Nicht die Leistungen machen die Person, sondern die Person, die von Gott erschaffen und erlöst ist, erbringt Leistungen. Nicht gute Werke machen gute Menschen; vielmehr vermögen nur gute Menschen gute Werke hervorzubringen.
Im Licht dieser Botschaft von der Gnade Gottes setzt sich der Christ, der im Glauben vom Primat des Seins vor dem Leisten überzeugt ist, für das Leben der Menschen und ihre undelegierbare Würde ein, und zwar vor allem jener Menschen, deren Leben auf der Börse der heutigen Leistungsgesellschaft einen schlechten Kurswert haben, genauer für das ungeborene Leben, das noch nichts leisten kann, und für das alternde, leidende und sterbende Leben, das nichts mehr leisten kann. Der Christ macht sich deshalb stark für das Gottesrecht auf das Menschenleben von der Empfängnis bis zum Tode. Der christliche Rechtfertigungsglaube erweist sich von daher als Anwaltschaft der Gnade mitten in der heutigen Gesellschaft, die von individueller und struktureller Gnadenlosigkeit so sehr bedroht ist.
Die Botschaft von der Gnade Gottes enthält auch einen kritischen Zwischenruf in die heutige kirchliche Situation hinein. Die Kirche ist berufen und verpflichtet, den Primat des Empfangens vor dem Tun, des Sich-von-Gott-Beschenken-Lassens vor dem eigenen Leisten an erster Stelle im kirchlichen Lebens selbst zum Tragen zu bringen. Denn gegenüber dem Menschen, der sich seiner eigenen Leistung rühmen will, besteht der Apostel Paulus darauf, dass der Mensch letztlich alles, was er ist und was er hat, nicht als Resultat seines eigenen Tuns buchen darf, sondern von Gott nur als letztlich unverdientes Geschenk empfangen kann: „Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen?“ (1 Kor 4, 7).
Im Gegensatz zu diesem Primat des Empfangens vor dem eigenen Tun wird freilich auch in der Kirche heute das Machen und Leisten gross geschrieben bis dahin, dass man von einer neuen Form des Pelagianismus reden muss. In der pastoralen Situation von heute wird uns freilich Vieles wieder aus der Hand genommen, von dem wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemeint haben, wir hätten es geschaffen und wir hätten es dabei geschafft. Heute müssen wir jedoch stets deutlicher feststellen und dabei auch mühsam lernen, dass wir nicht (mehr) in der Lage sind, mit unseren Kräften, mit unseren finanziellen Mitteln, mit unserem Personal, mit unseren Kräften, mit unserer Kreativität und unserem Prestige allein die Kirche aufzubauen. Die in den vergangenen Jahrzehnten eingeübte und auch heute noch weithin vorherrschende Mentalität, dass wir selbst die Kirche aus eigener Kraft gestalten und nach unserem Belieben ordnen können, wird durch die Realität immer mehr in Frage gestellt. Angesichts solcher Erfahrungen dürfen und müssen wir wieder offen werden für die im Glauben wach werdende Frage, ob sich mit den gravierenden Veränderungen und einschneidenden Entwicklungen in unserer Kirche Gott neu in unser Bewusstsein bringen will. Er will uns vor allem in Erinnerung rufen, dass nicht wir die Schöpfer der Kirche sind, sondern dass er der Herr seiner Kirche ist. Könnte es nicht sein, dass in der heutigen Situation der Kirche Gott uns die schöne Notwendigkeit der Gnade wieder in Erinnerung rufen will?
(2) Mitwirken des Menschen beim Rechtfertigungsgeschehen
Mit der emphatischen Betonung der Gnade Gottes und des Primats des Empfangens vor dem Tun ist allerdings die Frage nach dem Mitwirken des Menschen keineswegs auf die Seite geschoben. Die Frage nach dem Zusammenwirken zwischen der Gnade Gottes und der Freiheit des Menschen stellt vielmehr den zweifellos sensibelsten und schwierigsten Punkt im bisher erreichten Konsens in der Rechtfertigungslehre dar.
In der evangelischen Tradition besteht die starke Tendenz, dass die Bedingungslosigkeit der rechtfertigenden Gnade Gottes ein Mittun des Menschen nicht zulässt, da die Alles-Wirksamkeit Gottes auch die Allein-Wirksamkeit Gottes bedeutet, mit der auf Seiten des Menschen bloss noch reine Passivität angenommen werden könnte und müsste. Diese Schlagseite der evangelischen Rechtfertigungslehre hat der katholische Theologe Karl-Heinz Menke auf die Kurzformel gebracht: „Handeln Gottes an uns ohne uns“. Demgegenüber ist der katholische Glaube überzeugt, dass das Handeln Gottes am Menschen ein „Bundesgeschehen“ ist[13] und dass folglich im Rechtfertigungsgeschehen der Mensch nicht nur Objekt des Heilshandelns Gottes ist, sondern als Subjekt des Glaubens auch mitwirkt. Diese Glaubenssicht bringt der Katechismus der Katholischen Kirche mit den Worten zum Ausdruck: „Die Rechtfertigung begründet ein Zusammenwirken zwischen der Gnade Gottes und der Freiheit des Menschen. Sie äussert sich dadurch, dass der Mensch dem Wort Gottes, das ihn zur Umkehr auffordert, gläubig zustimmt und in der Liebe mit der Anregung des Heiligen Geistes zusammenwirkt, der unserer Zustimmung zuvorkommt und sie trägt.“[14]
Diese Unterscheidung zwischen der evangelischen und katholischen Sicht wird heute nicht wenigen Christen wie eine theologische Spitzfindigkeit erscheinen. Sie verliert aber diesen Eindruck, sobald wir bedenken, dass sie fundamentale Konsequenzen nicht nur bei der Heiligen- und vor allem Marienverehrung hat, sondern auch für das Verständnis der Kirche und ihrer Ämter. Die kontroverse Frage, die sich dabei stellt, geht dahin, ob Gott uns Menschen allein „in“ der Kirche oder ob er uns auch „durch“ die Kirche begegnet. Das Bekenntnis, dass Gott „in“ der Kirche wirkt, dürfte auch evangelischen Christen kaum Schwierigkeiten bereiten. Doch ihnen fällt das Bekenntnis schwer, dass Gott auch „durch“ die konkrete Kirche wirkt. Katholische Theologie versteht deshalb die Kirche als Zeichen und Werkzeug des Heils oder, wie es das Zweite Vatikanische Konzil in Erinnerung gerufen hat, als universales Sakrament des Heils.
Es macht dabei das Verdienst der von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands und der Katholischen Kirche in Finnland gemeinsam verantworteten Erklärung über Kirche, Eucharistie und Amt „Communion in Growth“ aus, einen bedeutsamen Konsens hinsichtlich der Sakramentalität der Kirche zum Ausdruck gebracht zu haben.[15] Diese Erklärung ist aber in der Evangelischen Kirche in Deutschland auf sehr wenig Anerkennung gestossen, was zeigt, dass im Verständnis von Kirche nach wie vor gravierende Differenzen zwischen den Kirchen vorliegen. Die Sakramentalität der Kirche in dem Sinne, dass die Kirche das Heil Gottes nicht nur verkündet, sondern ihr auch eine heilsvermittelnde Sendung zukommt, gehört aber zu jenen Glaubensüberzeugungen, die für die Katholische Kirche beim „Austausch der Gaben“ unaufgebbar ist und deshalb als elementare Gabe in das ökumenische Bewusstsein einbringen muss.[16]
3. Gemeinchristliche Anthropologie als ökumenische Herausforderung
Im Katechismus der Katholischen Kirche findet sich die Darstellung der Lehre von Gnade und Rechtfertigung in der Mitte des ethischen Teils unter dem Titel „Das Leben in Christus“ und damit im Rahmen der anthropologischen Frage nach dem rechten Tun des Menschen.[17] Der Grund für diese Verortung liegt darin, dass in katholischer Sicht die christliche Ethik nicht einfach eine Gesetzethik ist, sondern vielmehr eine dialogische Ethik, die das sittliche Handeln des Menschen aus seiner personalen Begegnung mit Gott entfaltet, und zwar in der Überzeugung, dass die Grösse der Gnade Gottes gerade darin besteht, dass sie den Menschen zu seinem Mitwirken einlädt.
a) Ökumenischen Konsens bei ethischen Fragen finden
In diesem grösseren Zusammenhang ergibt sich für die Sendung der Kirche in die Welt von morgen eine weitere wichtige Wegweisung aus den ökumenischen Dialogen. Wer diese aufmerksam beobachtet, muss feststellen, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der Ökumene gerade im Bereich der Ethik massive Spannungen und Divergenzen aufgetreten sind. Dabei handelt es sich um eine gravierende Veränderung in der ökumenischen Situation. Während in einer früheren Phase der Ökumenischen Bewegung das Losungswort geheissen hat: „Glaube trennt – Handeln eint“, ist dieses in der Zwischenzeit gleichsam dahingehend auf den Kopf gestellt worden, dass es auf der einen Seite zu einem grösseren Teil gelungen ist, alte konfessionelle Glaubensgegensätze zu überwinden oder zumindest Annäherungen entgegenzuführen, dass aber auf der anderen Seite grosse Unterschiede vor allem bei ethischen Fragen an den Tag getreten sind, vor allem auf zwei Feldern, nämlich auf der einen Seite bei der ethischen Thematik von Ehe, Familie, Sexualität, besonders im Horizont des heutigen Gender-Mainstream und auf der anderen Seite bei den bioethischen Herausforderungen am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens.
Diesen Herausforderungen muss sich die christliche Ethik heute stellen und sich mit den zu Tage getretenen Divergenzen auf ethischem Gebiet beschäftigen. Denn wenn die christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zu den grossen ethischen Fragen des menschlichen Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht mit einer Stimme sprechen können, wird die christliche Stimme in den säkularisierten Gesellschaften von heute vor allem in Europa immer schwächer, und dies schadet der Ökumene in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit.
Hinzu kommt eine weitere Herausforderung: Wenn man die genannten Entwicklungen näher analysiert, stellt sich die starke Vermutung ein, dass hinter den ethischen Problemen zumeist Fragestellungen stehen, die das Menschenbild betreffen. Denn ethische Handlungsanweisungen lassen sich nur verstehen, wenn nach dem menschlichen Subjekt zurückgefragt wird, von dem ethisches Handeln ausgesagt wird. Ob man den Menschen wesensgemäss als animal sociale versteht oder ob man seine individuellen Interessen als vorrangig einstuft, wird sich im ethischen Diskurs zweifellos auswirken. Einen noch grundlegenderen Unterschied macht es aus, ob man in anthropologischer Sicht die Religion bloss als ein Epiphänomen betrachtet, das unter Umständen auch vernachlässigt werden kann, oder ob man sich von der Überzeugung leiten lässt, dass der Mensch gleichsam von Natur aus religiös ist und die religiöse Dimension konstitutiv zum Menschseins des Menschen gehört. Auf jeden Fall entscheiden sich ethische Fragen letztlich am Menschenbild, von dem man sich leiten lässt; und dieses ist seinerseits vom Gottesbild abhängig.[18] Zumal angesichts der radikalen anthropologischen Herausforderungen, die heute mit den verschiedenen Gender-Theorien und vor allem den starken Strömungen des Transhumanismus gegeben sind, steht die christliche Ökumene vor der bedeutsamen Aufgabe, eine gemeinsame christliche Anthropologie wiederzugewinnen oder zu entwickeln, um jene Differenzen in der Ethik und in der Anthropologie zu überwinden, die in der Zwischenzeit sichtbar geworden sind.[19]
b) Die Menschenwürde im Gottesgeheimnis einbergen
Christliche Anthropologie und Ethik muss dabei von der gemeinsamen Überzeugung ausgehen, dass eine wirklich tragfähige Fundierung der Personwürde des Menschen und der sie charakterisierenden Unantastbarkeit und Unveräusserlichkeit ohne Transzendenzbezug nicht möglich ist, wie vor allem der evangelische Ökumeniker Wolfhart Pannenberg entschieden betont hat: Die Personwürde „gilt dann, weil in der Bestimmung des Menschen begründet und nicht in irgendwelchen vorfindlichen Merkmalen auch für die Menschen, die den Gebrauch ihrer Vernunft noch nicht oder nicht mehr haben. Die Ausstattung des Menschen mit Vernunft hat in der Geschichte leider nie gehindert, dass Menschen einander zu Tode brachten.“[20]
Dass die Orientierung an der Transzendenz Gottes dem Menschen, seinem Leben und seiner Würde zugute kommt, lässt sich bereits durch einen Blick in die Geschichte verdeutlichen. Die radikale Krise des Gottesgedankens, von der unsere säkularisierten Gesellschaften befallen sind, hat mit einer inhärenten Logik eine ebenso gefährliche Krise des menschlichen Selbstverständnisses nach sich gezogen, und dem von Friedrich Nietzsche proklamierten „Tod Gottes“ droht der „Tod des Menschen“ auf der Spur zu folgen. Denn wo Gott aus dem gesellschaftlichen Leben verabschiedet wird, besteht höchste Gefahr, dass auch die Würde des Menschen mit Füssen getreten wird. Auf diesen Schicksalszusammenhang hat der katholische Theologe Johann B. Metz immer wieder seinen warnenden Finger gelegt: „War es nicht dieses späte Europa, in der erstmals in der Welt der <Tod Gottes> öffentlich verkündet wurde? Und ist es nicht dieses Europa, in dem wir seit geraumer Zeit auch auf den <Tod des Menschen>, so wie wir ihn aus unserer bisherigen Geschichte kennen, vorbereitet werden?“[21]
Bereits in geschichtlicher Sicht dürfte deutlich sein, dass das Verschweigen Gottes in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit dem Menschen keineswegs zugute kommt. Wenn nämlich gemäss biblischer Überzeugung der Mensch das unantastbare Ebenbild Gottes ist, dann nagt das Verdrängen des Gottesbewusstseins in der heutigen gesellschaftlichen Öffentlichkeit in einer gefährlichen Weise auch an der Würde des menschlichen Lebens. In dieser Situation muss sich die ökumenische Gemeinschaft in neuer Weise zur Sendung verpflichten, den lebendigen Gott zu verkünden und den Menschen das Gottesgeheimnis als bergendes Obdach nahezubringen. Diese Sendung setzt voraus, dass die Christen selbst überzeugt sind, dass ihnen mit dem Evangelium Jesu Christi ein so grossartiges Geschenk anvertraut ist, dass sie es nicht für sich behalten können, sondern dass sie es freigebig an die Menschen weitergeben und dazu einladen, es zu empfangen.
4. Symphonie von Ökumene und Mission
Mit der letzten Perspektive blicken wir auf die Anfänge der Ökumenischen Bewegung zurück, woraus sich eine weitere Wegweisung für die Sendung in die Kirche von morgen ergibt. Die Ökumenische Bewegung hat ihren Ausgang genommen bei der Ersten Weltmissionskonferenz, die im Jahre 1910 im schottischen Edinburgh stattgefunden hat. Sie ist deshalb von Anfang an auch eine Missionsbewegung gewesen. Den an dieser Konferenz Teilnehmenden hat das Ärgernis vor Augen gestanden, dass sich die verschiedenen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften bei der Missionsarbeit konkurrenziert und damit der glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi vor allem in fremden Kulturen geschadet haben, weil zusammen mit dem Evangelium auch die europäischen Kirchenspaltungen in andere Kulturen hineingetragen worden sind. Die Teilnehmenden an der Missionskonferenz sind sich von daher der schmerzlichen Tatsache bewusst geworden, dass die fehlende Einheit unter den Christen das grösste Hindernis für die Weltmission darstellt. Denn ein glaubwürdiges Zeugnis der Christen in der Welt ist nur möglich, wenn die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Trennungen im Glauben und im Leben überwinden können. In Edinburgh hat deshalb vor allem der anglikanische Missionsbischof Charles Brent intensive Bemühungen um die Überwindung jener Differenzen in der Glaubenslehre und in der Theologie der Ordnung der Kirchen gefordert, die ihrer Einheit hinderlich im Wege stehen.
Mit diesen prophetisch zu nennenden Einsichten ist der missionarische Auftrag der Christen und der Kirche stets deutlicher zu einem wichtigen Thema auf der ökumenischen Traktandenliste geworden. Seit Edinburgh ist das Bewusstsein immer mehr gewachsen, dass die Missionsbewegung und die Ökumenische Bewegung unlösbar zusammengehören und dass sich Mission und Ökumene gegenseitig fordern und fördern[22], wie Kardinal Walter Kasper mit Recht hervorgehoben hat: „Eine missionarische Kirche muss auch eine ökumenische Kirche sein; eine ökumenisch engagierte Kirche ist die Voraussetzung für eine missionarische Kirche.“[23]
Was über die Zusammengehörigkeit von Mission und Ökumene im allgemeinen zu sagen ist, gilt auch und besonders im Blick auf jene epochale Herausforderung, vor der die Christenheit insgesamt heute steht und die als Neue Evangelisierung bezeichnet wird. Unter der bisherigen „missio ad gentes“ ist die pastorale Aufgabe verstanden worden, in Kulturen, die bislang ohne Beziehung zum Christentum gestanden haben, dem Evangelium von Jesus Christus erstmals in der Geschichte Lebensraum zu ermöglichen; sie wird deshalb als Erst-Evangelisierung bezeichnet. Demgegenüber meint die Neu-Evangelisierung das erneuerte Bemühen der Verkündigung des Evangeliums vor allem in jenen Gesellschaften, die zwar – wie vor allem in Europa – während Jahrhunderten eine christliche Sozialisierung durchlebt, jedoch im Prozess der Neuzeit – im Westen Europas – eine tiefgreifende Säkularisierung oder – im ehemaligen Osten Europas – eine kämpferische Vernichtungskampagne gegen den christlichen Glauben und eine rigorose Unterdrückung der christlichen Kirchen durchgemacht haben.
Im Blick auf dieses Projekt der Neuevangelisierung nimmt Papst Franziskus dasselbe Hindernis wahr, das bereits bei der Missionskonferenz in Edinburgh angesprochen worden ist. Denn er ist überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit der christlichen Verkündigung sehr viel grösser wäre, „wenn die Christen ihre Spaltungen überwinden würden“[24], die der Verkündigung des Evangeliums Schaden zufügen: „Angesichts der Gewichtigkeit, die das Negativ-Zeugnis der Spaltung unter den Christen besonders in Afrika und Asien hat, wird die Suche nach Wegen der Einheit dringend.“ In den Augen von Papst Franziskus ist von daher der „Einsatz für eine Einheit, die die Aufnahme Jesu Christi erleichtert, nicht länger blosse Diplomatie oder eine erzwungene Pflichterfüllung und verwandelt sich in einen unumgänglichen Weg der Evangelisierung.“[25]
Das Postulat der Verknüpfung von Evangelisierung und ökumenischer Suche nach der Wiederherstellung der Einheit der Kirche stellt freilich keine neue Herausforderung dar, sondern ist im Grunde so alt wie das Christentum selbst und geht bis in den Abendmahlssaal zurück, in dem Jesus vor seinem Leiden und Sterben um die Einheit seiner Jünger mit der besonderen Intention gebetet hat: „damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Menschen ebenso geliebt hast wie mich“ (Joh 17, 23). Mit diesem Finalsatz im Hohepriesterlichen Gebet des Herrn bringt der Evangelist Johannes zum Ausdruck, dass die Einheit unter den Jüngern kein Selbstzweck sein kann, sondern im Dienst einer überzeugenden Verkündigung des Evangeliums steht und die unerlässliche Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der christlichen Evangelisierung darstellt.
Um eine solche neue Missionsinitiative in Gang bringen zu können, braucht es jene dynamische Beweglichkeit, die bereits Jesus seinen Jüngern zugemutet hat, indem er von ihnen gefordert hat, möglichst wenig auf die Missionsreise mitzunehmen: „Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüsst niemand unterwegs!“ (Lk 10, 4) Eine ähnliche Zumutung hat Papst Benedikt XVI. an die heutige Kirche mit dem Stichwort einer notwendigen und tiefgreifenden „Entweltlichung“ im Dienst einer glaubwürdigen Mission gerichtet.[26] Der Papst ist dabei überzeugt gewesen, dass die Kirche zu einer solchen Entweltlichung oft von aussen verholfen worden ist, beispielsweise durch die verschiedenen Epochen der Säkularisierung, die zur Streichung von Privilegien und zur Enteignung von Kirchengütern geführt und der Kirche wieder das Gesicht weltlicher Armut gegeben haben.
Das Postulat der Entweltlichung impliziert dabei keineswegs einen Rückzug der Kirche aus der Welt, sondern bedeutet im Gegenteil die Vorsorge dafür, dass das missionarische Zeugnis der Kirche in der Welt als glaubwürdig wahrgenommen werden kann, wie Papst Benedikt XVI. ausdrücklich hervorgehoben hat: „Das missionarische Zeugnis der entweltlichten Kirche tritt klarer zutage. Die von materiellen und politischen Lasten und Privilegien befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben.“[27] Das innere Geheimnis einer solchen christlichen Mission liegt dabei in einem überzeugten und deshalb überzeugenden christlichen Leben, das von der unaufgebbaren Glaubensüberzeugung getragen ist, dass ein Christ und eine Kirche, die nicht mehr missionieren, bereits demissioniert haben.
5. Austausch der Gaben – auch innerkatholisch
Für die Sendung der Kirche in die Welt von morgen dürften mit diesen Hinweisen einige wesentliche Wegweisungen genannt sein, die sich aus dem ökumenischen Austausch der Gaben ergeben haben. Ein solcher Austausch der Gaben legt sich aber auch innerkatholisch nahe, indem die verschiedenen Ortskirchen einander mit ihren besonderen Gaben bereichern. Das Ansgar-Werk hat gewiss stets viele Gaben in den Norden Europas geschenkt. Heute scheint es mir aber angebracht, einmal umgekehrt nach den Gaben zu fragen, die die Katholische Kirche in den nordischen Ländern Europas uns in unseren Breitengraden zu geben vermag. Im Zusammenhang der Fragerichtung der 50. Theologische Studienwoche des Ansgarwerkes möchte ich vor allem an zwei kostbare Gaben erinnern, die wir hierzulande dankbar in Empfang nehmen dürfen.
Wer einmal in einem nordischen Land in einer katholischen Gemeinde einen Gottesdienst feiern durfte, ist einer weitgehend multikulturellen Gemeinschaft begegnet, deren Mitglieder aus bis zu fünfzig verschiedenen Völkern und Nationen stammen und die gemeinsam die eine Eucharistie feiern. Man gewinnt dabei den Eindruck, erneut in einer pfingstlichen Versammlung anwesend zu sein, wie Lukas in der Apostelgeschichte die beginnende Kirche als jenes Volk beschrieben hat, das aus allen Völkern kommt und besteht. Das Neue von Pfingsten hat Papst Benedikt XVI. sehr tief mit den Worten zum Ausdruck gebracht: „Die Kirche ist von Anfang an katholisch; das ist ihr tiefstes Wesen.“[28] „Katholisch“ ist dabei auch ein anderes Wort für „universal“.
Eine katholische Gemeinde im Norden Europas repräsentiert gleichsam die Universalkirche im Kleinen. Die Universalität der katholischen Kirche ist dabei die beste christliche Gegenwehr gegen den heute wieder im Wachsen begriffenen Nationalismus, der nicht nur in der Gesellschaft festzustellen ist, sondern manchmal auch eine kirchliche Variante aufweist, wenn eine Ortskirche sich einbildet, die Lehrmeisterin der weltweiten Kirche zu sein. Die Kirche im Norden Europas hat die besondere Berufung, die Bedeutung und Schönheit der Universalität der Kirche im Glaubensbewusstsein in Europa wach zu halten. Die Universalität der Christenheit zeigt sich in Nordischen Ländern zudem durch die Präsenz nicht nur von verschiedenen katholischen Rituskirchen, sondern auch von Orientalischen und Evangelischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften.
Die katholischen Gemeinden in den nordischen Ländern sind zweitens nicht nur multikulturell, sondern sie sind zumeist auch klein und leben somit in der Diaspora. Ein Kenner der Kirche in den nordischen Ländern charakterisiert diese Kirche mit den treffenden Worten: „Die Diasporakirche des Nordens ist eine wachsende Kirche, die ihren missionarischen Auftrag in der Neuevangelisierung erfüllt.“[29] Sie erinnert so an die frühe Kirche in der Geschichte, die in der Sozialgestalt der Diaspora gelebt, aber eine lebendige, missionarische und wachsende Kirche gewesen ist. Die Diasporakirche des Nordens wird von daher mit ihrem Glaubenszeugnis immer mehr auch eine Ermutigung für die Kirche in unseren Breitengraden, die sich stets spürbarer von der ehemaligen Volkskirche zur heutigen Diasporakirche verwandelt, wie dies der grosse Glaubenszeuge und Märtyrer Alfred Delp bereits während des Zweiten Weltkriegs im Kontext eines Vortrags über „Vertrauen zur Kirche“ festgestellt hat: „Wir sind Missionsland geworden.
Diese Erkenntnis muss vollzogen werden.“[30] Diese Diagnose hat in der Zwischenzeit nichts an Aktualität eingebüsst, sondern nimmt stets dramatischere Ausmasse an. Einen wesentlichen Grund für diese Entwicklung hat dabei ebenfalls Alfred Delp in der Gespaltenheit der Christenheit gesehen, über die er geurteilt hat: „Wenn die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben.“ Die Spaltungen sollen deshalb „unsere dauernde Schmach und Schande sein, da wir nicht im Stande waren, das Erbe Christi, seine Liebe, unzerrissen zu hüten.“[31]
Die Erfahrung der Universalität der Kirche und die Zuversicht, dass sie auch in ihrer Diasporagestalt eine lebendige und missionarische Kirche sein kann, sind in meinen Augen besondere Gaben, die die Kirche in den nordischen Ländern Europas uns hierzulande schenken kann, gleichsam als Gegengeschenke für die Gaben, die wir ihr – zumal mit der Hilfe des Ansgarwerks – geben. Je mehr wir auch solchen innerkirchlichen Austausch der Gaben pflegen, desto mehr dürfte auch der ökumenische Austausch der Gaben im Dienst einer glaubwürdigen missionarischen Kirche gedeihen.
[1] Johannes Paul II., Ut unum sint, bes. Nr. 41-76.
[2] Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten (Hamburg 1994) 170-180.
[3] J. Kardinal Ratzinger, Zum Fortgang der Ökumene, in: Ders, Kirche, Ökumene und Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie (Einsiedeln 1987) 128-134, zit. 131-132.
[4] Franziskus, Ansprache an eine Delegation des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel am 28. Juni 2013.
[5] Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 246.
[6] Vgl. K. Kardinal Koch, Auf dem Weg zu einer ökumenischen Feier des 1700. Jahrestags des Konzils von Nicaea (325-2025), in: P. Knauer, A. Riedl, D. W. Winkler (Hrsg.), Patrologie und Ökumene. Theresia Hainthaler zum 75. Geburtstag (Freiburg i. Br. 2022) 320-341.
[7] Vgl. K. Kardinal Koch, Gottes Gegenwart in ökumenischer Gemeinschaft bezeugen, in: G. Augustin, Ch. Schaller, S. Siedziewski (Hrsg.), Der dreifaltige Gott. Christlicher Glaube im säkularen Zeitalter. Für Gerhard Kardinal Müller (Freiburg i. Br. 2017) 479-506.
[8] Benedikt XVI., Begegnung mit Vertretern des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Augustinerkloster Erfurt am 23. September 2011.
[9] Benedikt XVI., Ansprache im Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche des Augustinerklosters Erfurt am 23. September 2011.
[10] Vgl. K. Kardinal Koch, Die katholische Kirche und die Confessio Augustana, in: G. Frank, V. Leppin, T. Licht (Hrsg.), Die „Confessio Augustana“ im ökumenischen Gespräch (Berlin 2022) 381-391.
[11] V. Leppin / D. Sattler (Hrsg.), Reformation 1517-2017. Ökumenische Perspektiven (Freiburg i. Br. – Göttingen 2014) 67.
[12] Vgl. K. Kardinal Koch, Ein Meilenstein auf dem Weg zur Einheit der Kirche. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre als ökumenische Errungenschaft und als bleibende Herausforderung, in: B. Oberdorfer und Th. Söding (Hrsg.), Wachsende Zustimmung und offene Fragen. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre im Licht ihrer Wirkung (Freiburg i. Br. 2019) 371-402.
[13] K.-H. Menke, Das Kriterium des Christseins. Grundriss der Gnadenlehre (Regensburg 2003) 16.
[14] Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1993.
[15] Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry. A Report from the Lutheran-Catholic Dialogue Commission for Finland (Helsinki 2017).
[16] Vgl. K-H. Menke, Sakramentalität. Wesen und Wunde des Katholizismus (Regensburg 2012).
[17] Katechismus der Katholischen Kirche, Artikel 13: Gnade und Rechtfertigung.
[18] Vgl. R. Weimann, Der Glaube an den dreifaltigen Gott und das Menschenbild, in: G. Augustin, Ch. Schaller, S. Siedziewski(Hrsg.), Der dreifaltige Gott. Christlicher Glaube im säkularen Zeitalter. Für Gerhard Kardinal Müller (Freiburg i. Br. 2017) 181-197.
[19] Vgl. K. Kardinal Koch, Der Mensch als ökumenische Frage: Gibt es (noch) eine gemeinchristliche Anthropologie? in: B. Stubenrauch / M. Seewald (Hrsg.), Das Menschenbild der Konfessionen. Achillesverse der Ökumene (Freiburg i. Br. 2015) 18-32.
[20] W. Pannenberg, Christliche Rechtsüberzeugungen im Kontext einer pluralistischen Gesellschaft, in: Ders., Beiträge zur Ethik (Göttingen 2004) 55-68, zit. 60.
[21] F.-X. Kaufmann / J. B. Metz, Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum (Freiburg i. Br. 1987) 130.
[22] Vgl. K. Kardinal Koch. Neuevangelisierung und Ökumene gehören zusammen. Eine notwendige Identitätsvergewisserung, in: B. Stühlmeyer (Hrsg.), Auf Christus getauft. Glauben leben und verkünden im 21. Jahrhundert (Kevelaer 2019) 70-86.
[23] W. Kasper, Eine missionarische Kirche ist ökumenisch, in: Ders., Wege zur Einheit der Christen = Gesammelte Schriften. Band 14 (Freiburg i. Br. 2012) 521-534, zit. 523.
[24] Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 244.
[25] Ebda., Nr. 246.
[26] Vgl. K. Kardinal Koch, Entweltlichung und Neuevangelisierung: Gegensatz oder Synthese? Theologische Perspektiven von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI., in: G. Gänswein (Hrsg.), Fides et ratio im Denken und Wirken Benedikts XVI. = Ratzinger-Studien. Band 23 (Regensburg 2022) 101-121.
[27] Benedikt XVI., Ansprache bei der Begegnung mit in Kirche und Gesellschaft engagierten Katholiken im Konzerthaus in Freiburg im Breisgau am 25. September 2011.
[28] Benedikt XVI., Homilie am Pfingstsonntag, 15. Mai 2005.
[29] H.-J. Röhrig, Die Diaspora des Nordens. Christen aus der weltweiten Ökumene – internationale Ordensgemeinschaften, in: M. Heim / W. Buchmüller / G. Wozniak (Hrsg.), Christus verkünden. Zum missionarischen Charakter des Evangeliums. Festschrift für Karl Josef Wallner (Regensburg 2024) 285-291, zit. 291.
[30] A. Delp, Vertrauen zur Kirche (1941), in: Ders., Gesammelte Schriften. Band 1: Geistliche Schriften. Hrsg. von R. Bleistein (Frankfurt a. M. 1982) 263-283, zit. 280.
[31] A. Delp, Das Schicksal der Kirchen (1944/45), in: Ders., Gesammelte Schriften. Band IV: Aus dem Gefängnis. Hrsg. von R. Bleistein (Frankfurt a. M. 1984) 318-323, zit. 319.