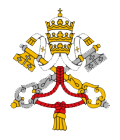JOHANNES PAUL II.
EIN UNERSCHROCKENER ZEUGE DES GLAUBENS
Festvortrag bei der Feierlichen Eröffnung
des „John Paul II - Mother Teresa International Research Centre in Vallendar
Vallendar (Deutschland), den 8. Dezember 2024
Die Feierliche Eröffnung des „John Paul II – Mother Teresa International Research Centre“ lädt dazu ein, einen Blick auf den Hauptprotagonisten zu werfen, dem dieses Centre gewidmet ist. Wenn man versuchen soll, den heiligen Papst Johannes Paul II. mit einem Wort zu charakterisieren, würde ich an erstes Stelle dieses wählen: Karol Wojityla – Johannes Paul II. ist eine äusserst starke Persönlichkeit gewesen: stark von Natur aus und stark in der übernatürlichen Berufung, stark in ihren Überzeugungen und stark in ihrem Willen, stark in ihrer Ausstrahlung und in ihrer Angefochtenheit, stark in ihrem Wirken und stark in ihrem Leiden und Sterben. Deshalb und auch wegen seiner sportlichen Gestalt hat er in Italien den Namen «atleta di Dio» - „Athlet Gottes“ erhalten[1].
Eine starke Persönlichkeit
Die Stärke ist dabei bereits in der Biographie dieser Persönlichkeit begründet. Karol Wojityla hat die Härten des menschlichen Lebens sehr früh am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er ist noch nicht einmal neun Jahre alt gewesen, als seine Mutter gestorben ist. Als zwölfjähriger hat er seinen älteren Bruder Edmund verloren, den er sehr geliebt und auch bewundert hat. Und zehn Jahre später ist auch sein Vater gestorben. Karol Wojityla ist erst zwanzig Jahre alt gewesen, als er keinen einzigen nahen Angehörigen auf der Welt mehr gehabt hat.
Nach dem Tod seines Vaters hat er vier Jahre lang im Arbeitermilieu zugebracht, als er während des Krieges und der Besatzung in einer Chemiefabrik Zwangsarbeit verrichten musste. Im Rückblick hat er aber diese Periode in seinem Leben als jene Bildungsphase bezeichnet, die für ihn am entscheidendsten gewesen sei. Denn unter solchen Umständen hat er nicht nur Philosophie studiert, deren wichtiges Thema für ihn stets der Mensch gewesen ist. In dieser Zeit ist vielmehr auch seine geistliche Berufung gereift, so dass er am 1. November 1946 zum Priester geweiht werden konnte. Seine Zugehörigkeit zum Priesterseminar von Kardinal Sapieha ist dabei von den Kommunisten als ein Akt des Widerstandes betrachtet worden. Auch während der Besatzung Polens durch die Nationalsozialisten hat er an verbotenen Theateraufführungen selbst auf die Gefahr hin teilgenommen, von der Gestapo erwischt und ins Konzentrationslager eingeliefert zu werden.
Auch als Gemeindepfarrer hat er den kommunistischen Machthabern getrotzt und den Bau einer neuen Kirche organisiert, um das fünfzigjährige Bestehen der Pfarrei würdig feiern zu können. Als Erzbischof von Krakau hat er in sich die Berufung gespürt, im Namen Gottes einen langen Kampf gegen den staatlich verordneten Atheismus austragen zu müssen; denn er ist vom menschenfeindlichen Grundzug des Kommunismus zutiefst überzeugt gewesen. Diesen Kampf hat er auch fortgesetzt, als er im Jahre 1978 als erst 58-jähriger Kardinal zum ersten slawischen Papst in der Kirchengeschichte gewählt worden ist.
In diesem Kampf musste er während seines 27jährigen Pontifikats einen langen und harten Weg gehen. Er hat einen politisch motivierten Mordanschlag überlebt, und er hat mit seinem Kampf Recht erhalten; denn das Sowjetreich existiert nicht mehr. Kein geringerer als Michael Gorbatschow hat über diesen Papst gesagt: „Was in Europa in den letzten Jahren geschehen ist, wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Papst, ohne Johannes Paul II., ohne die grosse politische Rolle, die er im Weltgeschehen gespielt hat.“ Der Papst hat wesentlich zum Zusammenbruch der kommunistischen Regimes in Osteuropa beigetragen. Sein Herzenswunsch, Moskau zu besuchen und Russland dem Herzen Mariens zu weihen und damit dem Wunsch der Muttergottes von Fatima zu entsprechen, ist freilich nicht in Erfüllung gegangen. Er ist aber für viele Menschen und Völker zu einem grossen und grossartigen «Zeugen der Hoffnung» geworden, wie George Weigel seine umfangreiche Biographie über Johannes Paul II. mit Recht betitelt[2].
Leidenschaft für die Würde und Grösse des Menschen
Der äusserst geraffte Rückblick in das äussere Leben von Karol Wojtyla – Johannes Paul II. zeigt, dass mit ihm eine eindrückliche Persönlichkeit mit sehr starken Charakterzügen vor uns steht. Diese zeigen sich auch darin, dass Papst Johannes Paul II. das, was er weltgeschichtlich bewegt und gewirkt hat, auch selbst in seiner Lehrverkündigung entschieden vertreten hat.
Dies gilt zunächst von seinen drei grossen Sozialenzykliken „Laborem Exercens“ (1981), „Sollicitudo Rei Socialis“(1987) und „Centesimus Annus“ (1991), in denen er in der menschlichen Arbeit «den wesentlichen Schlüssel in der gesamten sozialen Frage» gesehen hat, sofern sie «vom Standpunkt des Wohls für den Menschen betrachtet» wird[3]. Für Papst Johannes Paul II. hat stets die Würde des Menschen und seiner Arbeit im Mittelpunkt gestanden, weshalb er die christliche Lehre vom Menschen auf die sozialen Probleme in der damaligen Gesellschaft angewendet hat. In kritischer Auseinandersetzung sowohl mit dem kollektivistischen Marxismus als auch mit dem individualistischen Liberalismus hat er stets den Vorrang des Menschen gegenüber den Produktionsmitteln, den Vorrang der Arbeit gegenüber dem Kapital und den Vorrang der Ethik gegenüber Technik und Politik betont. Vor allem in seiner dritten Sozialenzyklika „Centesimus Annus“ im Jahre 1991 hat der Papst in aller Deutlichkeit vor einer einseitigen Marktorientierung gewarnt, die die sozialen und gesamtgesellschaftlichen Orientierungen nicht berücksichtigt, und er hat der westlichen Welt vor Augen geführt, dass sie nach der Wende in Europa verpflichtet ist, eine soziale Marktwirtschaft zu entwickeln.
Mit der sozialen Botschaft des Papstes sehr eng zusammen hängt auch sein leidenschaftlicher Einsatz für das menschliche Leben von seinem Beginn bis zu seinem natürlichen Ende, für einen umfassenden Lebensschutz und für eine „Kultur des Lebens“ angesichts der heutigen von ihm so genannten „Zivilisation des Todes“. Im Licht des Glaubens nimmt der Papst im Menschen – in jedem Menschen, ob er klein oder gross, schwach oder kräftig, funktionstüchtig oder angeblich unnütz ist – das Bild Gottes wahr, in dem jedem einzelnen Menschen eine unantastbare Würde zugesprochen ist. Weil sie von der Würde Gottes umkleidet ist, darf sie niemandem zur Disposition stehen. Diesem ihm besonders am Herzen liegenden „Evangelium des Lebens“ hat er eine eigene Enzyklika mit dem Titel „Evangelium Vitae“ (1995) gewidmet, die man als prophetisches Wort in unsere Zeit hinein würdigen muss, zumal in unseren Breitengraden, in denen bereits das ungeborene Leben nicht mehr geschützt und das fundamentale Recht auf Leben in sein Gegenteil, ein angebliches Recht auf Abtreibung uminterpretiert und politisch durchgesetzt wird.
Auf dem Hintergrund des ruinösen Verfalls des Rechts auf Leben, der auch in den heutigen Diskussionen über die Euthanasie zu Tage tritt, hat Papst Johannes Paul II. eine tiefe Krise des moralischen Bewusstseins wahrgenommen und in der Infragestellung des moralischen Gewissens eine grosse Gefahr für die Menschheit gesehen. Er hat sich deshalb vor allem mit seiner Enzyklika „Veritatis splendor“ (1993) um eine neue Aktualisierung der moralischen Botschaft des christlichen Glaubens bemüht. Dabei ist es sein entscheidendes Anliegen, die Gewissheit und Konkretheit der moralischen Dimension, die durch Jesus Christus in die Welt getragen worden ist, aufzuzeigen und die Gläubigen zu ermutigen, sie so glaubwürdig zu leben, dass sie auch ausserhalb der Kirche einsichtig werden kann. Von daher hat er auch dazu ermutigt, sich die moralische Weisheit der grossen religiösen Traditionen und der menschlichen Vernunft anzueignen und in der sensiblen Wahrnehmung der moralischen Lehre der Schöpfung die Lehre des Schöpfers selbst zu erkennen. Dazu ist die Wiederentdeckung der metaphysischen Sicht der Wirklichkeit notwendig, die der Papst in seiner Enzyklika in der Überzeugung entfaltet, dass die Vernunft des Menschen ihre Wahrheit und ihre Autorität aus der Weisheit Gottes schöpft, nämlich aus dem ewigen Gesetz. Er sieht deshalb im Naturgesetz „das von Gott uns eingegebene Licht des Verstandes“[4].
Eine tiefe moralische Krise hat der Papst nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Kirche diagnostiziert und sich von daher um die Fundamente der Moraltheologie gesorgt. Dazu hat er sich intensiv mit der in der damaligen Zeit wirksam gewordenen Moraltheologie, der so genannten „autonomen Moral“ befasst, die davon ausgegangen ist, dass es keine in sich schlechten Handlungen geben kann, dass als moralisch vielmehr dasjenige zu gelten hat, was von den voraussehbaren Folgen her als am meisten positiv und deshalb gut erscheint. Wenn es jedoch keine in sich schlechten Handlungen geben können soll, kann es auch das Gute als solches nicht geben. Wenn man die Konsequenzen eines solchen Denkens auf sich wirken lässt, beginnt man zu verstehen, weshalb der Papst einen langen Abschnitt in der Enzyklika vor allem dem Martyrium widmet, nämlich in der Überzeugung: Wenn es nichts mehr geben sollte, wofür das Leben hinzugeben sich lohnt, droht auch das Leben leer zu werden. Wenn es jedoch das unbedingt Gute gibt, für das zu sterben sich lohnt, dann gibt es auch das immer Schlechte, das nie gut oder auch nur besser werden kann. Und nur so ist die moralische Würde des Menschen in Kraft.
Das intellektuelle Fundament der Enzyklika „Veritatis Splendor“ liegt in der Beziehung zwischen Glaube und Vernunft. Der Kombination von Glaube und Vernunft hat Papst Johannes Paul II. seine bedeutende Enzyklika „Fides et Ratio“ (1998) gewidmet. Sie ist von der tiefen Überzeugung getragen, dass der christliche Glaube keineswegs gegen die menschliche Vernunft steht und sie auch nicht zum Schweigen bringen will, dass der Glaube vielmehr den Mut der Vernunft zu sich selbst braucht. Umgekehrt besteht die Aufgabe des Glaubens darin, die in den positivistischen Wissenschaften und von daher im heutigen Zeitgeist metaphysisch müde und deshalb eindimensional gewordene Vernunft zu weiten und sie zur Suche nach der Wahrheit zu ermutigen. Denn ohne Vernunft droht der Glaube zu verfallen, und ohne Glaube droht die Vernunft zu verkümmern. Damit kommt an den Tag, dass das ganze Denken und die integrale Lehrverkündigung von Papst Johannes Paul II. in der Zumutung der Erkennbarkeit der Wahrheit und der Verkündigung der christlichen Botschaft als erkannter Wahrheit bestehen. In Glaube und Vernunft erblickt er deshalb die entscheidenden Wege, die zur Wahrheit führen. Sie sind gleichsam die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt.
Im Dienst am Frieden und an der Versöhnung
Die Lebensethik des Papstes und sein Einsatz für die Würde des Menschen sind – im Unterschied zu seiner Sozialethik – häufig als konservativ oder zu eng kritisiert worden. Demgegenüber ist der Papst mit Recht überzeugt gewesen, dass die Kultur des Lebens und die Ethik des Sozialen unlösbar miteinander verbunden sind. Denn ohne ein konsequentes Ja zum Leben des Menschen ist eine Gesellschaft in ihrer Lebendigkeit selbst bedroht. Mit gleicher Konsequenz wie für das Leben ist Johannes Paul II. deshalb immer wieder für Friede und Versöhnung zwischen den Menschen und Völkern eingetreten. Ich erinnere mich besonders an den energischen Kampf des gesundheitlich bereits sehr schwach gewordenen Papstes gegen den Krieg im Irak, bei dem er für sehr viele Menschen zum Symbol der gemeinsamen Hilflosigkeit angesichts des unerbittlichen Kriegswillen des amerikanischen Präsidenten geworden ist. Dieser Einsatz des Papstes ist aber nur die letzte Konsequenz verschiedener prophetischer Zeichen seines entschiedenen Willens zur Versöhnung zwischen den Menschen und Völkern und zwischen den Religionen gewesen.
Was den interreligiösen Dialog betrifft, ist an erster Stelle an die zwei Friedensgebete in Assisi im Oktober 1986 und im Jahr 2001 zu erinnern, zu denen der Papst Vertreter der verschiedenen Religionen eingeladen hat, um gemeinsam zu bekennen, dass die Zwillingschwester des Friedens nie die Gewalt sein darf, sondern nur der Friede und dass die unbedingte Voraussetzung dafür in der Anerkennung der Religionsfreiheit besteht. Beim Dialog mit dem Islam ragen vor allem die folgenden Ereignisse hervor: Sein Besuch in der Al-Azhar-Hochschule in Kairo, der wichtigsten islamischen Autorität in Religionsfragen, bei dem der Papst eine gemeinsame Erklärung zum Verzicht auf Gewalt im Namen Gottes erreichen konnte, und später sein Besuch in der Omajjaden-Moschee in Damaskus, in der der Papst ein Zeichen des Willens dafür gesetzt hat, dass der Konflikt zwischen Muslimen und Christen für immer beendet werden sollte.
Besonders am Herzen hat Papst Johannes Paul II. die Versöhnung mit dem jüdischen Volk gelegen, die bereits in seiner Biographie tief verwurzelt gewesen ist, insofern in der Grundschule in Wadowice mindestens ein Viertel seiner Mitschüler Juden gewesen sind, mit denen er in Freundschaft verbunden gewesen ist. Während seines ganzen Pontifikats hat er immer wieder Begegnungen mit Repräsentanten des Judentums gepflegt. Nachdem er im Jahre 1986 als erster Papst in der Geschichte die Synagoge in Rom besucht hatte, ist er im Heiligen Jahr 2000 zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gepilgert und hat erklärt: „Als Bischof von Rom, Nachfolger des Heiligen Petrus, versichere ich dem jüdischen Volk, wie bestürzt die katholische Kirche über alle Verbrechen ist, die von Christen an Juden begangen wurden. So etwas darf sich niemals wiederholen.“ Noch berührender ist das demütige Stehen des Papstes vor der Klagemauer in Jerusalem gewesen, in deren Ritzen er eine Gebetsbitte hinterlassen hat.
Auch und besonders das ökumenische Anliegen der Wiedergewinnung der sichtbaren Einheit der Christen zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Pontifikat von Papst Johannes Paul II. Er ist von der Überzeugung getragen gewesen, dass nach dem Ersten Jahrtausend der Christentumsgeschichte, das die Zeit der ungeteilten Kirche gewesen ist, und nach dem Zweiten Jahrtausend, das im Westen und im Osten der Kirche zu tiefen Spaltungen geführt hat, das Dritte Jahrtausend die grosse Aufgabe zu bewältigen haben wird, die verloren gegangene Einheit der Christen wiederherzustellen. Im Blick auf diese Verantwortung ist der Papst ebenfalls überzeugt gewesen, dass das Amt, das dem Nachfolger des Petrus aufgetragen ist, das Amt der Einheit ist und dass es im Bereich der Ökumene „seine ganz besondere Erklärung“ findet[5].
In dieser Überzeugung hat er bereits im Jahre 1985 die Enzyklika „Slavorum Apostoli“ verfasst, die im ökumenisch wichtigen Beziehungsfeld zwischen Ost und West angesiedelt ist und das Verhältnis von Glaube und Kultur, genauer die kulturschöpferische Kraft des Glaubens entfaltet. Von besonderer Bedeutung ist die Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene „Ut Unum Sint“, die er im Jahre 1995 veröffentlicht und das ökumenische Anliegen in einer sehr synthetischen Weise zum Ausdruck gebracht hat.[6] Über diese Enzyklika hat Joseph Kardinal Ratzinger als sein sehr enger Mitarbeiter geurteilt, der Papst habe die „Suche nach der Einheit der Getauften gemäss dem Auftrag des Herrn, gemäss der inneren Logik des Glaubens, der als Kraft der Einheit von Gott in die Welt gesandt ist, mit der „ganzen Leidenschaft seines ökumenischen Wollens“ ins Bewusstsein der Kirche gerückt[7]; und er hat dieses Engagement mit den Worten begründet: „Der Papst empfang die Teilung der Christenheit von Anfang an als eine Verletzung, die ihn sehr persönlich betraf, bis hin zum physischen Leiden“, und er sah es deshalb als seine Aufgabe an, „alles zu tun, um zu einer Wende auf die Einheit zu kommen. Deshalb hat er seine ganze ökumenische Leidenschaft in diesen Text gelegt“[8].
Ohne diese persönliche Betroffenheit wahrzunehmen, kann man das grosse ökumenische Bemühen von Johannes Paul II. im Allgemeinen und seine Enzyklika „Ut unum sint“ im Besonderen nicht verstehen. Dabei verdienen vor allem zwei wichtige Perspektiven in der Enzyklika eine spezielle Erwähnung. Johannes Paul II. ist sich dessen bewusst gewesen, dass das Amt des Bischofs von Rom „eine Schwierigkeit für den Grossteil der anderen Christen“ darstellt, „deren Gedächtnis durch gewisse schmerzliche Erinnerungen gezeichnet ist“[9], die dazu geführt haben, dass das Amt des Bischofs von Rom als eines der grössten Hindernisse auf dem Weg zur Wiederherstellung der Einheit der Christen betrachtet wird. Im Bewusstsein dieser Hypothek hat er die Bitte an die gesamte Ökumene ausgesprochen, sich mit ihm auf einen „brüderlichen und geduldigen Dialog“ über den Primat des Bischofs von Rom einzulassen, und zwar mit dem Ziel, eine Form der Primatsausübung zu finden, „die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet“, genauer dahingehend, dass dieses Amt „einen von den einen und anderen anerkannten Dienst der Liebe zu verwirklichen vermag“[10].
Die zweite Perspektive betrifft die sensible Wahrnehmung, dass die Christenheit in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart erneut Märtyrerkirche geworden ist und dass alle christlichen Gemeinschaften ihre Märtyrer haben und das Martyrium folglich ökumenisch ist. In der Ökumene der Märtyrer hat Johannes Paul II. den „bedeutendsten Beweis“ dafür gesehen, „dass in der Ganzhingabe seiner selbst an die Sache des Evangeliums jedes Element der Spaltung bewältigt und überwunden werden kann“[11]. Die Ökumene der Märtyrer ist für ihn die überzeugendste Gestalt der Ökumene, weil sie mit lauterer und klarerer Stimme spricht als die Verursacher der Spaltungen und weil das Blut, das die Märtyrer für Christus vergiessen, uns Christen nicht trennt, sondern eint. Trotz aller schmerzvollen Tragik der Christenverfolgungen erblickt Papst Johannes Paul II. in dieser Situation auch eine positive Botschaft: Wie die frühe Kirche ihren Glauben mit der Überzeugung zum Ausdruck gebracht hat, dass das Blut der Märtyrer Same von neuen Christen ist – „Sanguis martyrum semen Christianorum“ – so dürfen auch wir Christen heute in der Hoffnung leben, dass das Blut von so vielen Märtyrern Same für die künftige Einheit des von so vielen Spaltungen verwundeten Leibes Christi sein wird. Wir dürfen sogar überzeugt sein, dass wir im Blut der Märtyrer bereits eins geworden sind.
Auf dem Weg zur Jahrtausendwende
Das unermüdliche Arbeiten von Papst Johannes Paul II. für die Einheit der Christen, für die Versöhnung mit dem Judentum, für den Dialog mit den Religionen und für den Frieden in der Welt hat er schliesslich verdichtet im grossen „Mea culpa“ am Ersten Fastensonntag im Heiligen Jahr 2000, indem er im Namen und für die Kirche um Vergebung gebeten und die Sünden der Christen bekannt hat, nämlich die Verbrechen der Religionskriege und der Inquisition, die Sünden gegen die Einheit der Christen, die Sünden gegen die Juden, die Sünden gegen den Frieden und das Völkerrecht und die Sünden gegen die Gerechtigkeit.
Das „Mea culpa“ hat der Papst für notwendig erachtet, damit die Kirche mit neuer Glaubwürdigkeit die Botschaft des Evangeliums in der Welt verkünden kann. Damit kommt ein weiteres wichtiges Anliegen an den Tag, das Johannes Paul II. sehr am Herzen gelegen hat, nämlich eine notwendige Neu-Evangelisierung vor allem in jenen Gesellschaften, die eine lange Geschichte der Christianisierung hinter sich haben, sich aber immer mehr vom Christentum entfremdet haben. Mit seinem Aufruf „Die Stunde fordert eine neue Evangelisierung“[12] hat er auf die grossen Veränderungen in den europäischen Ländern nach der Wende reagiert und zu einer Neuevangelisierung ermutigt, die neu in ihren Methoden und ihrer Ausdruckweise und vor allem in ihrem Eifer sein soll. Dazu hat er das Apostolische Schreiben „Tertio Millennio Adveniente“ verfasst, das man als hilfreiche Wegweisung für die Neuevangelisierung würdigen darf, nachdem er bereits zuvor dem christlichen Missionsauftrag die Enzyklika mit dem Titel „Redemptoris Missio“ (1990) gewidmet hat. Was er gelehrt hat, hat er freilich auch gelebt, indem er vor allem mit seinen zahlreichen Apostolischen Reisen das Evangelium Jesu Christi in die ganze Welt gebracht hat.[13]
Mit dem Programm der Neuevangelisierung wollte der Papst auf das grosse Jubiläum im Jahre 2000 hinführen. Vor allem im Apostolischen Schreiben „Tertio Millennio Adveniente“ hat er ein pastorales Programm für seine Vorbereitung und Feier entwickelt, das ganz dem trinitarischen Glauben der Kirche folgt, indem die unmittelbar vorangehenden Jahre jeweils einer Person in der göttlichen Dreifaltigkeit gewidmet sind und den göttlichen Personen des des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes die Sakramente der Taufe, der Busse und der Firmung zugeordnet werden.
Die Aufmerksamkeit auf das Heranrücken des Jahres 2000 hat Johannes Paul II. bereits in seiner Antrittsenzyklika „Redemptor Hominis“ hingelenkt, indem er von einem neuen Advent gesprochen hat, in dem die Kirche lebt und auf den sie zugeht. Denn das Datum, an dem die Kirche der Menschwerdung Gottes gedenken wird, ist ein Datum der Hoffnung. In dieser Enzyklika sind bereits die wichtigsten Themen enthalten, die der Papst in den kommenden Jahren entfalten wird, vor allem im grossen trinitarischen Triptychon, das er in den Jahren 1979 -1096 in den drei Enzykliken „Redemptor Hominis“, „Dives in Misericordia“ und „Dominum et Vivificantem“ verfasst hat.
Die erste Enzyklika „Redemptor Hominis“ (1979) kreist ganz um die Frage danach, was der Mensch im Licht des christlichen Glaubens ist, und mündet in den Spitzensatz, dass alle Wege der Kirche zum Menschen hin führen und der Mensch folglich der „Weg der Kirche“ ist[14]. So verhält es sich aber nur deswegen, weil Jesus Christus selbst der „Hauptweg der Kirche“ ist: „Er selbst ist unser Weg zum Haus des Vaters und ist auch der Zugang zu jedem Menschen.“[15] Denn wer der Mensch wirklich ist, dies kann nur von jenem vollkommenen Menschen her erkannt werden, der zugleich Gott ist, nämlich Jesus Christus. Wie es um den Menschen steht und welche Wege er gehen soll, dies ist in Jesus Christus offenbart worden, wie Papst Johannes Paul II. sehr tief sagt: „In Christus und durch Christus hat sich Gott der Menschheit vollkommen geoffenbart und sich ihr endgültig genähert. Gleichzeitig hat der Mensch in Christus und durch Christus ein volles Wissen um seine Würde, um seine Erhebung, um den transzendenten Wert des eigenen Menschseins und um den Sinn seiner Existenz erworben.“[16] Damit zeigt sich vollends, dass die unendliche Würde, die jedem Menschen eigen ist, nur von der Erkenntnis Jesu Christi, dem Geheimnis seiner Menschwerdung und der Erlösung eingesehen und wahrgenommen werden kann.
Diese Glaubensüberzeugungen erhalten dann ihr besonderes Gewicht, wenn man sie auf dem biographischen Hintergrund von Papst Johannes Paul II. versteht, der bereits in seinen frühen Lebensjahren „eine persönliche Erfahrung der Ideologien des Bösen“ machen musste[17], zunächst mit dem Nationalsozialismus und dann mit dem Kommunismus. Bernhard Häring hat von daher die Antrittsenzyklika von Papst Johannes Paul II. mit Recht als „Lebenstheologie“ und als „lebensnahes Glaubensbekenntnis“ gewürdigt[18].
Während im Mittelpunkt der Antrittsenzyklika Jesus Christus als der Sohn in der innergöttlichen Trinität und als Erlöser der Menschen steht, ist die zweite Enzyklika „Dives in Misercordia“ (1980) Gott-Vater gewidmet. Weil der Sohn Jesus Christus „Licht vom Licht und Gott von Gott“ ist, entspricht es der inneren Logik, dass nun Gott der Vater ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wird, zumal auch die Frage nach dem Menschen mit der Frage nach Gott unlösbar verbunden ist. So lautet denn auch die erste Überschrift in der Enzyklika „Wer mich sieht, sieht den Vater“. Dieses johanneische Wort Jesu Christi über sich selbst bringt es an den Tag, dass er den himmlischen Vater uns Menschen ganz offenbart hat. Als den innersten Wesenszug Gottes des Vaters stellt die Enzyklika dabei das göttliche Erbarmen ins Zentrum, das vor allem mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das besser Gleichnis vom barmherzigen Vater heissen sollte, verdeutlicht wird, um von daher das Paschamysterium, das Erbarmen Gottes in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi zu bedenken. Denn in Christus und durch Christus „wird Gott auch in seinem Erbarmen besonders sichtbar“, was bedeutet: „jene göttliche Eigenschaft tritt hervor, die schon das Alte Testament in verschiedenen Bildern und Ausdrucksweisen als <Erbarmen> beschrieben hat“[19]. Damit hat der Papst die Zuversicht verbunden, dass auch das Böse in der Welt, dessen Urheber und Opfer zugleich der Mensch ist, an eine ihm gesetzte Grenze stossen wird und „dass diese Grenze letztendlich die göttliche Barmherzigkeit ist“[20].
Einen wesentlichen Impuls für die Enzyklika hat Papst Johannes Paul II. gewiss aus der mystischen Frömmigkeit der Nonne Faustyna Kowalska in Krakau erhalten, deren wichtiges Anliegen darin bestanden hat, das Erbarmen Gottes in die Mitte des christlichen Glaubens und Lebens zu heben, um in der heutigen Zeit mit der Erbarmungslosigkeit ihrer Ideologien die Neuheit des Christlichen zum Leuchten zu bringen. Um das Geheimnis des göttlichen Erbarmens im Leben der Kirche neu zu verwurzeln, hat Papst Johannes Paul II. den zweiten Ostersonntag besonders diesem Geheimnis gewidmet; und man darf es wohl als liebenswürdiges Zeichen der göttlichen Vorsehung annehmen, dass er selbst am Vorabend des Barmherzigkeitssonntags 2005 sein irdisches Leben beschliessen und in die barmherzigen Hände des himmlischen Vaters aufgenommen werden durfte.
Abgeschlossen wird das trinitarische Triptychon mit der dritten Enzyklika über den Heiligen Geist, die den Titel trägt: „Dominum et Vivifcantem“ (1986). Johannes Paul II. geht dabei aus von einer Meditation des Johannesevangeliums, genauer vor allem von all dessen, was Jesus während des Letzten Abendmahles gesprochen hat, und zwar in der Überzeugung, dass in den letzten Stunden seines irdischen Lebens die wohl umfassendste Offenbarung über den Heiligen Geist geschehen ist. Ein besonderes Gewicht legt der Papst dabei auf die Aussage Jesu, der Heilige Geist werde die „Welt der Sünde überführen“ (Joh 16, 8.). Die tiefste Wurzel der Sünde erblickt er in der Lüge und damit in der Zurückweisung der Wahrheit: „Der <Ungehorsam> als ursprüngliche Dimension der Sünde bedeutet, die Zurückweisung dieser Quelle wegen des Anspruchs des Menschen, selbst autonome und alleinige Quelle für die Bestimmung von Gut und Böse zu werden“[21]. Da aber die Frucht des rechten Gewissens darin besteht, „das Gute und das Böse beim Namen zu nennen“[22], stellt der Papst erneut die Wahrheit ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wobei Gutheit, Wahrheit und Freiheit unlösbar zusammenhängen und die Würde des Menschen ausmachen: „Der Mensch ist nämlich dazu berufen, mit seiner Freiheit die Wahrheit über das Gute anzunehmen und zu verwirklichen.“[23] Die eigentliche Gabe des Heiligen Geistes nimmt der Papst von daher im „Geschenk der Wahrheit des Gewissens“ und im „Geschenk der Erlösung“ wahr: „Der Geist der Wahrheit ist auch der Beistand.“[24]
Auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils
Versucht man, den Reichtum des trinitarischen Triptychons zu überblicken, erschliesst sich auch der persönliche Denkweg des Theologen und Hirten und späteren Papstes. Auf dem Hintergrund der personalistischen Philosophie, die er vertreten und gefördert hat, ist das entscheidende Thema seiner Philosophie stets der Mensch gewesen[25], wie er es später auch als Papst zum Ausdruck gebracht hat, der Mensch sei der Weg der Kirche. Der Mensch lag Papst Johannes Paul II. aber deshalb am Herzen, weil ihm Gott am Herzen gelegen hat. Da er die tiefste Krise der Zeit im Verschwinden Gottes aus dem Leben der Menschen und aus dem Horizont der menschlichen Geschichte und damit in einer elementaren „Gotteskrise“ wahrgenommen hat, hat er die entscheidende Sendung der Kirche darin gesehen, Gott zu bezeugen und dabei immer weniger von sich selbst und immer mehr von Gott zu sprechen. Von Gott kann man als Christ jedoch nicht sprechen, ohne von Jesus Christus zu reden, in dem sich Gott selbst zu erkennen gegeben hat. Erst von daher erhält die Aussage des Papstes, der Weg der Kirche sei der Mensch, ihren authentischen Sinn, da der Mensch im vollen Sinne dieses Wortes allein Jesus Christus, der Erlöser der Menschen ist. In den Augen von Johannes Paul II. ist die Lehre vom Menschen deshalb nicht einfach eine philosophische Theorie, sondern hat vielmehr einen ganz existenziellen Charakter, insofern das sie bewegende Thema die Frage nach der Erlösung des Menschen ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die lehramtliche Verkündigung von Papst Johannes Paul II. ist eine starke Anthropozentrik. Sie ist aber kein Anthropozentrismus, der den Menschen an die Stelle Gottes setzt; seine Anthropozentrik ist zuinnerst Theozentrik. Seine Theozentrik ist dabei Christozentrik, und seine Christozentrik ist im Kern Soteriologie, Lehre von der Erlösung. Dabei ist mit zu bedenken, dass alle grossen Themen des christlichen Glaubens in den Augen von Papst Johannes Paul II. in der Mariologie zusammenfliessen. Dies zeigt sich bereits daran, dass jede seiner Enzykliken mit einem verdichtenden Hinweis auf die Mutter Gottes beschlossen wird. Ihr hat er später eine eigene Enzyklika „Redemptoris Mater“ (1987) gewidmet, in der er die Bedeutung Marias im Geheimnis Jesu Christi und „ihre aktive und beispielhafte Gegenwart im Leben der Kirche“ bedenkt[26]. Dabei besteht, wie Hans Urs von Balthasar hervorgehoben hat, der „geniale Griff der Enzyklika“ vor allem darin, „den Glauben Marias ins Zentrum gerückt zu haben“, wie es „vielleicht noch keine Mariologie getan“ hat[27]. Damit ist die Einladung verbunden, dass die Kirche von Maria ihr Kirchesein neu zu lernen hat.
Maria hat bei Papst Johannes Paul II. einen herausragenden Platz freilich nicht nur in der Heilsgeschichte und in der Geschichte der Kirche, sondern auch in seinem persönlichen Leben, wie er in seinem hingebungsvollen päpstlichen Leitwort „Totus Tuus“ zum Ausdruck kommt: Der Christ muss Gott dienen wie Maria, die sich ihm ganz hingegeben hat. Im „Totus Tuus“ ist die spirituelle Erfahrung eines Glaubenslebens verdichtet, das durch Maria ganz auf Christus ausgerichtet ist.
Führt man sich das Panorama des Päpstlichen Lehramtes, wie es seinen Ausdruck in den grossen Enzykliken gefunden hat, vor Augen, dürfte deutlich sein, wie sehr es auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils steht. Dies kann nicht erstaunen, wenn man bedenkt, dass Karol Kardinal Wojityla selbst am Konzil teilgenommen und mitgewirkt hat[28], vor allem bei der Erarbeitung der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et Spes“, die wesentlich von der Sorge um den Menschen geprägt ist. Kardinal Wojityla hat das Konzil als Meilenstein bei der Erneuerung der Kirche erfahren. Nach dem Ende des Konzils hat er sich darum bemüht, in der ihm anvertrauten Diözese Krakau in Polen das Konzil umzusetzen, und dazu hat er eine eigene „Studie zur Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils“ verfasst[29]. Auch als Papst hat er das Konzil als grosses Geschenk an die Kirche gewürdigt, das für ihn den sicheren Kompass dargestellt hat, „um uns auf dem Weg des jetzt beginnenden Jahrhunderts zu orientieren“[30].
Angesichts dieser verbindlichen Treue zum Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils erweist es sich nur als konsequent, dass es Papst Johannes Paul II. auch ein wichtiges Anliegen gewesen ist, die Lehre des Konzils auch in die kanonistische Sprache zu übersetzen. Dies ist mit der Veröffentlichung des neuen Kirchenrechts, des Codex Iuris Canonici im Jahre 1983 geschehen. Bei seiner Promulgation hat der Papst hervorgehoben, das Zweite Vatikanische Konzil, vor allem seine Lehre über die Kirche, habe nicht nur den inneren Anlass, sondern auch das Kriterium für die Erneuerung des kirchlichen Gesetzbuches gebildet. Er hat sogar betont, der Codex gehöre zum Konzil und sei in diesem Sinn „das letzte Dokument des Konzils“[31].
Dabei verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass Papst Johannes Paul II. zum ersten Mal in der Geschichte zwei Rechtsbücher promulgiert hat, nämlich neben dem Codex von 1983 für die Lateinische Kirche auch das Gesetzbuch für die Katholischen Ostkirchen, den Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium im Jahre 1990. Diese Tatsache ist auch in ökumenischer Hinsicht besonders bedeutsam[32], weil den Katholischen Ostkirchen eine spezifische Verantwortung für die Einheit der Christen zugesprochen wird, wie der Papst in seinem Apostolischen Schreiben „Pastores Gregis“ eigens vermerkt: „Es besteht kein Zweifel darüber, dass den katholischen Ostkirchen aufgrund ihrer spirituellen, geschichtlichen, theologischen, liturgischen und disziplinären Nähe zu den orthodoxen Kirchen und den anderen orientalischen Kirchen, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, eine ganz besondere Rolle vor allem zur Förderung der Einheit der Christen des Ostens zukommt.“[33]
Im Dienst am Glauben
Blicken wir von da nochmals auf das gesamte Lehramt von Papst Johannes Paul II. zurück, dann stellen wir fest, dass er während seines Pontifikats nicht weniger als vierzehn Enzykliken veröffentlicht hat, die ein ganzes Panorama an Themen des christlichen Glaubens und kirchlichen Lebens behandeln.[34] Neben dem bereits genannten trinitarischen Triptychon, den drei Sozialenzykliken, den anthropologischen Enzykliken sind nochmals die Enzykliken über die Kirche hervorzuheben, deren letzte diejenige über die Eucharistie gewesen ist.
Dies ist kein Zufall; denn für Papst Johannes Paul II. ist die Eucharistie nicht einfach eines der sieben Sakramente, sondern das Sakrament der Sakramente, das die Kirche nicht nur feiert, sondern aus dem sie immer wieder neu entsteht und aus dem sie lebt. Wie der Titel „Ecclesia de Eucharistia“ (2003) anzeigt, hat er darin eine eucharistische Ekklesiologie entfaltet. In der Eucharistie ist für ihn das Geheimnis Gottes ganz konkret erfahrbar, wie er selbst bekennt: „Wenn ich an die Eucharistie denke und dabei auf mein Leben als Priester, Bischof und Nachfolger Petri blicke, erinnere ich mich spontan an die vielen Momente und an die Orte, an denen es mir gegeben war, sie zu feiern… Diese so vielfältige Szenerie meiner Eucharistiefeiern lässt mich deutlich ihren universalen und sozusagen kosmischen Charakter erfahren. Ja, kosmisch. Denn auch dann, wenn man sie auf dem kleinen Altar einer Dorfkirche feiert, wird die Eucharistie immer in einem gewissen Sinn auf dem Altar der Welt zelebriert. Sie verbindet Himmel und Erde. Sie erfasst und erfüllt alles Geschaffene.“[35]
Man hat in der Enzyklika über die Eucharistie mit Recht das geistliche Testament des Papstes gesehen. In ihr wird deshalb auch das Geheimnis dieses Papstes sichtbar. Denn man kann seine Persönlichkeit nur verstehen, wenn man ihn bei der Feier der Heiligen Messe erfahren hat, während der er ganz mit Christus verbunden gewesen ist und auf die er sich stets in spiritueller Versunkenheit vorbereitet hat. Ein Journalist, der Papst Johannes Paul II. auf vielen seiner Reisen begleiten konnte, hat dieses Bekenntnis über ihn abgelegt: „Nichts hat Papst Johannes Paul II. je so gefesselt wie die Berührung mit dem Heiligen, dem Unerklärlichen, dem Übernatürlichen. Das Geheimnis dieses Papstes ist das Geheimnis selbst, das Jenseitige, das Wunderbare.“[36] In diesem Geheimnis hat der Journalist den tiefsten Grund dafür gefunden, dass er den Papst als „universellen Botschafter des einen unbegreiflichen, grossen Gottes“ erfahren konnte[37], der freilich kein verborgener Gott ist, sondern die konkrete Begegnung mit dem Menschen sucht.
Das Geheimnis von Papst Johannes Paul II. besteht genauer darin, dass der christliche Glaube an den lebendigen Gott das Fundament gewesen ist, auf dem er gelebt und gewirkt hat. Der Nachfolger des Petrus, des „Felsen“, hat selbst unbeirrbar auf dem Felsen des Glaubens und wie ein Fels in der Brandung der Zeit gestanden, an dem sehr viele Gläubige Halt gefunden und an dem sich andere gestossen haben – beispielsweise wegen seiner Kritik an befreiungstheologischen Strömungen, die Anleihen am Marxismus gemacht haben, wegen seiner Entscheidung der nur Männern vorbehaltenen Weihe oder wegen seines leidenschaftlichen Einsatzes für das ungeborene Leben. Ohne das Fundament des Glaubens hätte er das schwierige Erbe der nachkonziliaren Kirche, die bereits kurz nach dem Konzil aufgrund des ausgebrochenen Streits um die adäquate Interpretation dieser bedeutenden Kirchenversammlung zuhöchst polarisiert gewesen ist, nicht übernehmen und die Kirche im Spannungsfeld von Tradition und Erneuerung, von Glaubenstreue und Zeitgenossenschaft leiten können. Papst Johannes Paul II. hat diese Gratwanderung dadurch begangen, dass er sich stets an den Grundimpulsen des Zweiten Vatikanischen Konzils und noch viel grundlegender an der biblischen Botschaft orientiert hat.
In dieser Weise ist Papst Johannes Paul II. ein unermüdlicher und unerschrockener Zeuge des Glaubens gewesen. Dies gilt gewiss auch von der letzten Phase seines Lebens, in der er den gesundheitlichen Verfall seines Körpers erfahren musste, der immer mehr zu einem Gefängnis für seinen hellwachen Geist geworden war. Er hat sich aber nicht gescheut, seine körperliche Gebrechlichkeit, seine Behinderung und die unangenehmen Folgewirkungen seiner Parkinson-Krankheit öffentlich zu zeigen. Im Durchtragen seines physischen und auch spirituellen Leidens ist er vielen Menschen zu einer wichtigen Botschaft geworden, dass der Mensch auch in seinem Alter und Leiden seine Würde behält. Mit diesem Zeugnis hat er nochmals unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, wie er sich selbst verstanden hat: als ein ohnmächtiges Werkzeug des allmächtigen und barmherzigen Gottes. Die Art und Weise, wie er seine Krankheit und sein Leiden getragen hat, hat gewiss bei seiner Heiligsprechung eine nicht unbedeutende Rolle gespielt[38].
In der Heiligkeit ist die zweite Persönlichkeit, der das „John Paul II. – Mother Teresa International Research Centre“ gewidmet ist, Papst Johannes Paul II. sehr nahegekommen. Mutter Theresa von Kalkutta müsste in einem eigenen Vortrag eingehend gewürdigt werden. Es würde dann gewiss sichtbar werden, wie sehr die Heilige aus Albanien die Anliegen von Papst Johannes Paul II. geteilt hat. Zu denken ist dabei vor allem an die Zentralität der Barmherzigkeit Gottes, an den leidenschaftlichen Einsatz für das ungeborene Leben, das uneigennützige Engagement für die armen, kranken und leidenden Menschen und auch an ihre eigene Anteilhabe am schweren Leiden. Wohl deshalb sind sich Papst Johannes Paul II. und Mutter Theresa sehr eng verbunden gewesen. Und wohl deshalb ist das „John Paul II. – Mother Teresa International Research Centre“ gut beraten, es diesem geistlichen Zwillingspaar zu widmen.
[1] J. Ernesti, Geschichte der Päpste seit 1800 (Freiburg i. Br. 2024) 388.
[2] G. Weigel, Zeuge der Hoffnung. Johannes Paul II. Eine Biographie (Paderborn 2002).
[3] Johannes Paul II., Laborem Exercens, Nr. 3.
[4] Johannes Paul II., Veritatis Splendor, Nr. 40.
[5] Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten (Hamburg 1994) 85.
[6] Vgl. Kard. K. Koch, Ut unum sint – Die Enzyklika zur Vertiefung des ökumenischen Einsatzes der römisch-katholischen Kirche, in: Rocznik Teologiczny XIII (Warszawa 2020) 763-791.
[7] J. Ratzinger – Benedikt XVI., Der Glaube als Refugium der Humanität. Die 14 Enzykliken von Johannes Paul II., in: Ders., Johannes Paul II. Mein geliebter Vorgänger (Augsburg 2008) 43-61, zit. 54.
[8] J. Ratzinger – Benedikt XVI., Die Einheit von Mission und Person in der Gestalt von Johannes Paul II. Zwanzig Jahre einer Geschichte, in: Ders., Johannes Paul II. Mein geliebter Vorgänger (Augsburg 2008) 15-42, zit. 40.
[9] Johannes Paul II., Ut Unum Sint, Nr. 88.
[10] Ebda., Nr. 95-96.
[11] Ebda., Nr. 1.
[12] Johannes Paul II., Christifideles Laici, Nr. 34.
[13] Vgl. J. Navarro Alcantara, M. Alvarez Goghland, A. Ortega Ibarra, Johannes Paul II. – Der Weltenpilger (Città del Vaticano 2000).
[14] Johannes Paul II., Redemptor Hominis, Nr. 14.
[15] Ebda., Nr. 13.
[16] Ebda., Nr. 11.
[17] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2005) 28.
[18] B. Häring, Kommentar, in: Die Würde des Menschen in Christus. Die Antrittsenzyklika „Redemptor Hominis“ Papst Johannes Pauls II. (Freiburg i. Br. 1979) 111-140, zit. 113.
[19] Johannes Paul II., Dives in Misericordia, Nr. 2.
[20] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2008) 75.
[21] Johannes Paul II., Dominum et Vivificantem, Nr. 36.
[22] Ebda., 41.
[23] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2008) 61.
[24] Johannes Paul II., Dominum et Vivificantem, Nr. 31.
[25] Vgl. K. Wojityla – Johannes Paul II., Von der Königswürde des Menschen (Stuttgart 1980).
[26] Johannes Paul II., Redemptoris Mater, Nr. 1.
[27] H. U. von Balthasar, Kommentar, in: Maria – Gottes Ja zum Menschen. Johannes Paul II., Enzyklika „Mutter des Erlösers“ (Freiburg i. Br. 1987) 129-143, zit. 133.
[28] Vgl. R. Skrzypzak, Karol Wojityla al Concilio Vaticano II. La Storia e i Documenti (Verona 2011).
[29] K. Wojityla, Quellen der Erneuerung. Studie zur Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils (Freiburg i. Br. 1981).
[30] Johannes Paul II.., Novo Millennio Ineunte, Nr. 57.
[31] Johannes Paul II., Ansprache an die Bischöfe beim Kurs zur Einführung in den Codex Iuris Canonici am 21. 11. 1983.
[32] Vgl. K. Kardinal Koch, Die Gesetzgebungstätigkeit Johannes Pauls II. und die Förderung der Einheit der Christen, in: L. Müller - L. Gerosa (Hrsg.), Johannes Paul II. - Gesetzgeber der Kirche (Paderborn 2017) 151-167.
[33] Johannes Paul II., Pastores Gregis, Nr. 60.
[34] Vgl. Giovanni Paulo Teologo. Nel segno delle Encicliche. A. cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo (Milano 2003).
[35] Johannes Paul II., Ecclesia de Eucharistia, Nr. 8.
[36] A. Englisch, Johannes Paul II. Das Geheimnis des Karol Wojityla (München 2003) 28.
[37] Ebda., 360.
[38] Vgl. S. Oder und S. Gaeta, Darum ist er heilig. Der wahre Johannes Paul II. Erzählt aus der Sicht seines Postulators im Seligsprechungsprozess (Kisslegg 2014).