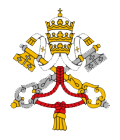GRUSSWORT
zur Antrittsvorlesung von Professor Dr. Stefanos Athanasiou
bei der Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München
den 28. Mai 2024
Sehr geehrter Herr Professor Athanasiou, lieber Stefanos
Verehrte Teilnehmende, liebe Schwestern und Brüder im Glauben
Aus Rom darf ich Ihnen meine besten Grüsse nach München senden, wo heute an der Ludwig-Maximilians-Universität die Antrittsvorlesung von Professor Stefanos Athanasiou stattfindet; dazu entbiete ich Ihnen meine besten Segenswünsche. Gerne benütze ich auch die Gelegenheit, der Universität meine dankbare Anerkennung auszusprechen, dass sie neben den beiden Theologischen Fakultäten auch die Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie unterhält und damit die grössere Weite der Ökumene in Deutschland nicht nur anzeigt, sondern auch fördert.
Der Dialog mit der Orthodoxen Kirche liegt der Katholischen Kirche in besonderer Weise am Herzen, und zwar auch deshalb, weil ihr unter allen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften die Orthodoxie ohne Zweifel am nächsten steht, wie dies Papst Benedikt XVI. bei einer Begegnung mit Vertretern von Orthodoxen Kirchen anlässlich seines Besuchs in Deutschland im Jahre 2011 mit den Worten zum Ausdruck gebracht hat: „Katholiken und Orthodoxe haben die gleiche altkirchliche Struktur bewahrt, in diesem Sinn sind wir alle alte Kirche, die doch immer gegenwärtig und neu ist.“[1] Diese enge Gemeinschaft ist vor allem darin begründet, dass in beiden Kirchengemeinschaften das ekklesiologische Grundgefüge bis heute erhalten geblieben ist, das sich seit dem Zweiten Jahrhundert herausgebildet hat, nämlich die sakramental-eucharistische und die episkopale Grundstruktur in dem Sinne, dass die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt in Apostolischer Sukzession als für das Kirchesein konstitutiv betrachtet werden.
Angesichts dieser grossen Übereinstimmung können im ökumenischen Dialog beide Kirchengemeinschaften voneinander lernen, indem sie jene ökumenische Lebensregel pflegen, die das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“ als „Austausch der Gaben“ bezeichnet hat. Dahinter steht die Überzeugung, dass keine Kirche so reich ist, dass sie nicht der Bereicherung durch andere bedürfte, dass aber auch keine Kirche so arm ist, dass sie nicht einen besonderen Beitrag in das grössere ökumenische Bewusstsein einbringen könnte.
Dieser ökumenische Lebensstil des „Austausches der Gaben“ legt sich nicht nur im Blick auf die Ekklesiologie nahe, sondern auch und zuerst im Blick auf die Anthropologie, die Professor Athanasiou zum Thema seiner Antrittsvorlesung macht. Auch in diesem wichtigen Bereich gibt es im ökumenischen Gespräch zwischen der Katholischen und der Orthodoxen Kirche noch immer offene Fragen. Zu denken ist dabei an die teilweise unterschiedlichen Sichten des Menschen und seines Verhältnisses zur Sünde, was besonders das Verständnis der Erbsünde betrifft. Diese Themen berühren dabei nicht nur anthropologische Fragen im engeren Sinn, sondern haben auch Konsequenzen in der Mariologie, was beispielsweise das Dogma der Unbefleckten Empfängnis Mariens betrifft, und erst recht in der Eschatologie, beispielsweise beim Thema des Fegefeuers.
Diese Fragen müssen im orthodox-katholischen Dialog weiterdiskutiert werden, um sie gemeinsam als zumindest nicht mehr kirchentrennend beurteilen zu können. Mit bestem Recht geht Professor Athanasiou aber die anthropologische Thematik in ihrer Kernmitte an, indem er die Vergöttlichung des Menschen in der orthodoxen Anthropologie vorstellt und bespricht. Damit nimmt er die entscheidende Herausforderung wahr, vor der orthodoxe und katholische Christen heute gemeinsam stehen und die in der Alternative besteht, ob in anthropologischer Sicht die Religion bloss als ein Epiphänomen betrachtet werden darf, das unter Umständen auch zu vernachlässigen ist, oder ob die Überzeugung tragfähig ist, dass der Mensch gleichsam von Natur aus religiös ist und die religiöse Dimension konstitutiv zum Menschsein des Menschen gehört, so dass man den Menschen ohne seine religiösen Bezüge und damit ohne Transzendenzbezug gar nicht adäquat verstehen kann.
Bei einer akademischen Veranstaltung in München legt sich dabei die Erinnerung nahe, dass sich dieser Herausforderung Wolfhart Pannenberg, verstorbener Systematischer Theologe an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität München intensiv gestellt hat, indem er in seinem Werk „Anthropologie in theologischer Perspektive“ erhellend dargetan hat, dass die in der neuzeitlichen sowohl empirischen als auch philosophischen Anthropologie im Mittelpunkt stehende Weltoffenheit des Menschen nur dann konsequent und radikal verstanden ist, wenn die Welt-Offenheit des Menschen als seine Gott-Offenheit ausgelegt und dementsprechend der Mensch als das nicht nur in die Welt hinein, sondern auch über die Welt als ganze hinaus offene und deshalb Gott-offene Lebewesen zu verstehen ist.[2]
Diese Perspektive in ökumenischer Gemeinschaft in den akademischen Diskurs und damit auch öffentlich zum Tragen zu bringen, ist von grundlegender Bedeutung angesichts der radikalen anthropologischen Herausforderungen an das christliche Menschenbild, die heute mit den verschiedenen Gender-Theorien und vor allem den starken Strömungen des Transhumanismus gegeben sind. Die christliche Ökumene steht deshalb heute vor der elementaren Aufgabe der Entwicklung und Bekräftigung einer am Evangelium orientierten gemeinchristlichen Anthropologie.[3] Diese Herausforderung hat bereits das Zweite Vatikanische Konzil wahrgenommen mit seiner Betonung, dass christliche Anthropologie zutiefst von der Christologie her entfaltet werden muss, wie es in der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“ heisst: „Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des Fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf.“[4] Dahinter steht die Überzeugung, dass Jesus Christus, der neue Adam, das wahre und endgültig-gültige Ebenbild Gottes ist und dass wir Christen nur dadurch Ebenbilder Gottes sind, dass wir im Gottessohn Jesus Christus Söhne und Töchter Gottes werden.
Noch tiefer bohrt Professor Athanasiou, wenn er die Theosis, die Vergöttlichung des Menschen in die Mitte christlicher Anthropologie stellt. Sie bildet in seinen Augen freilich nicht nur den innersten Kern der Anthropologie, sondern die Theosis als „Teilhabe des Endlichen am Ewigen in der Geschichte“ ist auch das „Ziel der Theologie“ überhaupt. Denn, wie Professor Athanasiou in einem anderen Zusammenhang schreibt, wer versuche, „das Heilige und Ewige für das rein Irdische und Menschliche zu tilgen“, der propagiere „letztlich keine Theologie, keine soteriologische Anthropologie, sondern eine anthropozentrische Anthropologie, die nicht das Heil der Menschheit im Mittelpunkt hat, sondern ideologische Interessen verfolgt“[5].
Im Licht einer solchen soteriologischen Theologie werden zwei weitere spezifische Dimensionen sichtbar, denen sich die Orthodoxie verpflichtet weiss. In einer soteriologischen Theologie bildet erstens die Theosis nicht nur des Menschen, sondern der ganzen Schöpfung das Ziel des Heilswirkens Jesu Christi. Während es in der westlichen Tradition immer wieder theologische Bestrebungen gegeben hat, die Erlösung des Menschen von derjenigen der Natur zu trennen, kann in der orthodoxen Tradition der Mensch nicht ausserhalb von Natur und Kosmos gedacht werden, wie beispielsweise der Rumänisch-Orthodoxe Theologe Dumitru Staniloae schreibt: „Nach unserem Glauben ist jede menschliche Person in gewisser Weise eine Hypostase der gesamten kosmischen Natur, freilich immer in engem Zusammenhang mit den anderen Geschöpfen“; und „die gesamte Natur ist für die Herrlichkeit bestimmt, deren die Menschen im Reich der Vollendung teilhaftig werden“[6]. Von daher ist es gewiss kein Zufall, dass eine bedeutende ökologische Vision der Sorge um die Schöpfung im Licht der christlichen Theologie zuerst in der orthodoxen Kirche vom Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. entfaltet worden ist und dass der erste ökologische Papst Benedikt XVI. gewesen ist, dem der geschwisterliche Dialog mit der Orthodoxie in besonderer Weise am Herzen gelegen hat, wie Professor Athanasiou als orthodoxes Mitglied des Neuen Schülerkreises Joseph Ratzinger-Benedikt XVI. aus eigener Erfahrung zu berichten weiss.
Mit der kosmologischen Dimension ist zweitens die doxologische eng verbunden. In der Orthodoxie lassen sich Theologie und Doxologie nicht strikt voneinander unterscheiden oder gar trennen, wie dies in der wesentlichen Tradition bis auf den heutigen Tag immer wieder geschieht. Wenn man nämlich überzeugt ist, dass das theologische Reden von Gott nur in glaubwürdiger Weise geschehen kann, wenn es vom doxologischen Reden zu Gott her kommt und in ihm wieder mündig wird, dann kann die entscheidende Frage nicht heissen, welchen Ort die Doxologie, das Gotteslob in Gebet und Liturgie, in der Theologie einnehmen; sie muss vielmehr lauten, welchen Ort die Theologie in der Doxologie hat. Nur auf diesem Wege kann der Grundversuchung widerstanden werden, dass sich die theologische Rede von Gott vom doxologischen Reden zu Gott loslöst und sich ins Abstrakte zurückzieht. Die Doxologie erweist sich vielmehr als Ernstfall, gleichsam als Purgatorium allen theologischen Denkens und Redens.
Die Wahrnehmung, dass die heutige Antrittsvorlesung mit dem Doxastikon des Ostersonntags begonnen hat, ist von daher nicht einfach als musikalisch-festliche Umrahmung zu verstehen, sondern enthält eine klare Botschaft. Die doxologische Ouvertüre weist auf den tieferen Sinn des Wortes „orthodox“ hin. Das darin enthaltene Wort „doxa“ bedeutet nämlich in erster Linie nicht „Meinung“ und „Lehre“, sondern „Herrlichkeit“. Unter Orthodoxie ist demgemäss die rechte Weise, Gott zu verherrlichen, zu verstehen. Diese doxologische Dimension aller Theologie in Erinnerung zu rufen und für die ökumenischen Dialoge fruchtbar zu machen: darin erblicke ich eine der besonderen Gaben, die die Orthodoxie in die ökumenischen Beziehungen und Gespräche einbringen kann.
In diesem Geist der dankbaren Zuversicht wünsche ich Professor Athanasiou, Dir lieber Stefanos, ein gutes Gelingen der heutigen Antrittsvorlesung und ein fruchtbares Wirken als Systematischer und Ökumenischer Theologe an der Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie. Und ich wünsche allen Teilnehmenden eine Bestärkung der Freude an der anthropologischen Hoffnung des christlichen Glaubens, dass Sein Leben auch unser Leben ist.
[1] Benedikt XVI., Begegnung mit den Vertretern der Orthodoxen Kirchen in Freiburg i. Br. am 24. September 2011.[2] W. Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive (Göttingen 1983).
[3] Vgl. K. Kardinal Koch, Der Mensch als ökumenische Frage: Gibt es (noch) eine gemeinchristliche Anthropologie? in: B. Stubenrauch / M. Seewald (Hrsg.), Das Menschenbild der Konfessionen. Achillesferse der Ökumene? (Freiburg i. Br. 2015) 18-32.
[4] Gaudium et spes, Nr. 22.
[5] St. Athanasiou, Absolutheitsanspruch des Dogmas und Lehrentwicklung in der orthodoxen Theologie und Tradition – Gegensatz oder Notwendigkeit? in: Ch. Ohly / J. Zöhrer (Hrsg.), „… was ich euch überliefert habe“. Verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche = Ratzinger-Studien. Band 25 (Regensburg 2023) 94-111, zit. 109.
[6] D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik. Band 1 (Zürich – Gütersloh 1985) 293-294.