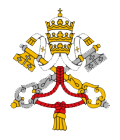PAPST BENEDIKT XVI. ZUR GLAUBENSWEITERGABE: INSPIRATION UND AUFBRUCH
Vortrag bei der 31. Theologischen Sommerakademie
zum Thema „Die Katholische Kirche. Tradition und Aggiornamento“
Augsburg, 2. September 2024
1. Mission und Evangelisierung als Schwerpunkte
Am 9. Juli 2012 hat Papst Benedikt XVI. das Zentrum „Ad gentes“ der Steyler-Missionare in Nemi besucht, wo er als junger Theologe bei der Erarbeitung des konziliaren Missionsdekretes mitgewirkt hat. Er hat die damalige Erfahrung als „vielleicht die schönste Erinnerung des gesamten Konzils“ gewürdigt. Denn es sei jenes „schöne und gute Dekret“ über die Mission entstanden, das von den Konzilsvätern fast einstimmig angenommen worden ist.[1] Wer sich auch heute das Konzilsdekret über die Missionstätigkeit der Kirche „Ad gentes“ vor Augen führt, wird unschwer erkennen, wie sehr die denkerische Vorarbeit des Theologen Joseph Ratzinger in dieses Dekret eingeflossen ist. Denn es ordnet den Missionsauftrag der Kirche in den weiten Horizont des universalen Heilsplanes Gottes mit der Menschheit ein, der auf die von den alttestamentlichen Propheten verheissene Sammlung aller Völker zielt: „Missionarische Tätigkeit ist nichts Anderes und nichts weniger als Kundgabe der Epiphanie und Erfüllung des Planes Gottes in der Welt und ihrer Geschichte, in der Gott durch die Mission die Heilsgeschichte sichtbar vollzieht.“[2]
Im Licht dieses epiphanischen Charakters der Mission hat Joseph Ratzinger stets hervorgehoben, dass es sich auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil beim Missionsthema in keiner Weise um eine nebensächliche Fragestellung gehandelt hat, sondern um ein Thema, das in das Zentrum der konziliaren Aussagen gehört; und er hat aufgezeigt, dass sich das Konzil in beinahe allen Konstitutionen, Dekreten und Erklärungen zum missionarischen Auftrag der Kirche geäussert und ihn perspektivenreich konkretisiert hat.[3] Die Omnipräsenz des Missionsthemas in den Lehrdokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils ist für Joseph Ratzinger so offenkundig, dass er später urteilen konnte, auf dem Konzil sei der eigentliche Gegensatz zu „konservativ“ gerade nicht „progessistisch“ gewesen, sondern „missionarisch“, und das Konzil habe insgesamt den „Übergang von einer konservierenden zu einer missionarischen Haltung“ markiert[4].
Die Konzentration auf das Missionsthema hat während des Petrusdienstes von Papst Benedikt XVI. eine konsequente Fortsetzung gefunden. Er hat die missionarische Überzeugung unter der Leitperspektive der Neuen Evangelisierung in die Mitte des kirchlichen Lebens gestellt, und zwar in bewusster Kontinuität zu seinen Vorgängern auf der Cathedra Petri[5]. Die Neue Evangelisierung unterscheidet sich dabei vor allem in einem wesentlichen Punkt von der „Missio ad gentes“. Diese kann man auch als Erst-Evangelisierung bezeichnen, da unter ihr die pastorale Aufgabe zu verstehen ist, das Evangelium den Menschen zu verkünden, die bis anhin ohne Beziehung zum Christentum gewesen sind und folglich Jesus Christus und seine Heilsbotschaft noch nicht kennen. Unter der Neuen Evangelisierung ist demgegenüber das erneute Bemühen der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi zu verstehen, die sich an jene Menschen richtet, die in „Gebieten alter christlicher Tradition“ leben, „wo das Licht des Glaubens schwach geworden ist, und die sich von Gott entfernt haben, ihn nicht mehr als für das Leben wichtig ansehen“ und deshalb einen „gewissen Schatz“ verloren haben[6].
Um das Projekt der Neuen Evangelisierung voranzubringen und zu vertiefen, hat Papst Benedikt XVI. vor allem drei Initiativen auf den Weg gebracht. Im Jahre 2010 hat er einen eigenen Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung in der Überzeugung errichtet, dass die Ortskirchen, die in traditionell christlichen Territorien leben, vor allem einen „erneuerten missionarischen Elan“ nötig haben, der „Ausdruck einer neuen hochherzigen Offenheit für das Geschenk der Gnade“ ist. Denn am Beginn einer jeden Evangelisierung steht keineswegs ein „menschliches Expansionsvorhaben“, sondern der „Wunsch, das unschätzbare Geschenk zu teilen, das Gott uns machen wollte, indem er uns an seinem eigenen Leben teilhaben liess“[7].
In der Wahrnehmung, dass in den heutigen Gesellschaften viele Menschen von einer tiefen Glaubenskrise befallen sind, hat Papst Benedikt XVI. zweitens im Blick auf den fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils ein Jahr des Glaubens mit der Zielbestimmung ausgerufen, „den Weg des Glaubens wiederzuentdecken, um die Freude und die erneute Begeisterung der Begegnung mit Christus immer deutlicher zu Tage treten zu lassen“[8]. Und im Bewusstsein, dass die Herausforderung der Neuevangelisierung „die universale Kirche auf den Plan“ ruft[9], hat Papst Benedikt XVI. drittens im Jahre 2012 die XIII. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode dem Thema „Die neue Evangelisierung und die Weitergabe des christlichen Glaubens“ gewidmet.
Mission, Neue Evangelisierung und Glaubensweitergabe bilden gleichsam den roten Faden, der sich durch das Leben und Wirken von Joseph Ratzinger-Benedikt XVI. zieht, und zwar seit seiner frühen Zeit. Bereits als junger Theologe hat er sich darum bemüht, die theologische Reflexion für die pastorale Weitergabe des Glaubens fruchtbar zu machen. In der sensiblen Wahrnehmung, dass in der pastoralen Situation der Kirche der „Weg vom Dogma zur Verkündigung“ mühsam geworden ist, hat er eine der Hauptaufgaben der Theologie darin gesehen, dass sie „Wegmarkierungen in den Alltag schaffen und Übertragungsmuster aus Reflexion in Verkündigung“ finden muss, da sich der theologische Gedanke erst in der „Sagbarkeit“ bewährt[10]. Und im Mittelpunkt seines Wirkens als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre hat die Erarbeitung und Veröffentlichung des „Katechismus der Katholischen Kirche“ gestanden, und zwar wiederum im Bewusstsein, dass der christliche Glaube „nicht zuerst ein Nährstoff für intellektuelle Experimente, sondern der feste Grund“ ist, „auf dem wir leben und sterben können“, und dass die Sprachgestalt des Katechismus nicht Theologie ist, sondern „Zeugnis, die aus der inneren Gewissheit des Glaubens kommende Verkündigung“[11].
2. Fundamentale Krise der Glaubensweitergabe
Auf diesem weiteren Hintergrund versteht man, dass Joseph Ratzinger in der Kirche sehr früh eine tiefe Glaubenskrise wahrgenommen hat. Bereits in den fünfziger Jahren hat er festgestellt, dass das dem Namen nach christliche Europa zur „Geburtstätte eines neuen Heidentums“ geworden ist, und er hat von einer „Kirche der Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden“, gesprochen[12]. Das deutlichste Symptom für diese Glaubenskrise hat er dabei in einer Krise der Glaubensweitergabe wahrgenommen, die im Kern darin besteht, dass der christliche Glaube heute nicht mehr einfach in traditioneller Weise weitergegeben wird, da die geschichtlich gewachsenen Vermittlungswege des Glaubens schwach geworden sind oder ganz ausfallen. In dieser neuen Situation droht der christliche Glauben wegzuschmelzen gleichsam wie der letzte Schnee vor der erstarkenden Frühjahrssonne. Wie der Glaube an die kommenden Generationen weitergegeben werden kann, ist deshalb zur Schicksalsfrage für die Kirche heute geworden. Bevor diese Frage im Geist von Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. zu beantworten versucht werden kann, muss die heutige Krise der Glaubens und der Glaubensweitergabe beim Namen genannt und in ihren entscheidenden Facetten in der gebotenen Kürze analysiert werden.
Der Krise des Glaubens und der Glaubensweitergabe in der Kirche heute liegt in einem weitgehenden Verblassen des biblisch-christlichen Bildes Gottes als eines in der Geschichte gegenwärtigen und handelnden Gottes. Dieses grundlegende Problem lässt sich am ehesten in der Kurzformel festmachen: „Religion ja – ein persönlicher Gott nein“. Diese Krise des Gottesglaubens ist dabei deshalb nicht leicht zu diagnostizieren, weil sie in einer an sich religionsfreundlichen Atmosphäre stattfindet. Mit ihr kommt jedoch zum Ausdruck, dass sich immer mehr auch Christen einen Gott nicht mehr vorstellen können, der in unserer Welt als gegenwärtig wahrgenommen werden kann, der in ihr handelt und sich um den einzelnen Menschen sorgt. Selbst Christen leben nicht selten, als ob es Gott nicht gäbe: „Deus non daretur“. Damit kommt an den Tag, dass sich der seit der europäischen Aufklärung aufgekommene Deismus praktisch im allgemeinen Bewusstsein durchgesetzt und selbst im kirchlichen Bewusstsein seinen Niederschlag gefunden hat, wie ihn Joseph Ratzinger mit deutlichen Worten charakterisiert: „Gott mag den Urknall angestossen haben, wenn es ihn schon geben sollte, aber mehr bleibt ihm in der aufgeklärten Welt nicht. Es scheint fast lächerlich sich vorzustellen, dass ihn unsere Taten und Untaten interessieren, so klein sind wir angesichts der Grösse des Universums. Es erscheint mythologisch, ihm Aktionen in der Welt zuzuschreiben.“[13]
Von daher versteht es sich von selbst, dass ein solchermassen deistisch verstandener Gott weder zum Fürchten noch zum Lieben ist. Es fehlt die elementare Leidenschaft an Gott; und darin liegt die tiefste Glaubensnot in der heutigen Welt, die durch eine dumpfe Taubheit gegenüber Gott charakterisiert ist. Das Leben nicht weniger Menschen und manchmal selbst von Christen ist von einer weitgehenden Gottvergessenheit geprägt, und zwar bis dahin, dass sie sogar vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben.
Die Krise des Gottesglaubens hat auch und vor allem elementare Konsequenzen für den Glauben an Jesus Christus. Denn wenn das biblische Gottesbild verblasst ist, ist auch die Gefahr gross, Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf den so genannt historischen Jesus und damit auf einen reinen Menschen zu reduzieren. Die durchschnittliche Einstellung des heutigen Menschen und selbst des Christen besteht darin, dass er sich zwar vor allem berühren lässt von allen menschlichen Dimensionen an Jesus, dass ihm aber das Bekenntnis, dieser Jesus sei der eingeborene Sohn Gottes, der als der Auferweckte in der Person des Heiligen Geistes unter uns gegenwärtig ist, und insofern der kirchliche Christusglaube weithin Mühe bereiten. Selbst in der Kirche will es heute oft nicht mehr gelingen, im Menschen Jesus das Antlitz des Sohnes Gottes wahrzunehmen und in ihm nicht einfach einen – wenn auch hervorragenden und besonders guten – Menschen zu sehen.
Die Krise des Christusbekenntnisses hat Joseph Ratzinger auf die Kurzformel gebracht: „Jesus ja, Christus nein“ oder „Jesus ja, Sohn Gottes nein“[14]. In dieser prekären Situation hat er den innersten Infekt der heutigen Krise des Christentums überhaupt wahrgenommen. Denn damit wird der christliche Glaube aus seinen Angeln gehoben: Wenn Jesus nur ein geschichtlicher Mensch vor zweitausend Jahren gewesen wäre, dann wäre er unwiderruflich in die Vergangenheit zurückgetreten, und nur unser fernes Erinnern könnte ihn dann mehr oder weniger deutlich in unsere Gegenwart zurückholen. Dann aber kann Christus in unserem Leben und im Leben der Kirche nicht als gegenwärtig wahrgenommen werden, und der Glaube an die Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie wäre ein Fremdwort. Schliesslich wäre auch der Zugang zum christlichen Glauben an die Erlösung und das ewige Leben verschlossen.
3. Wesentliche Inhalte bei der Glaubensweitergabe
Aus der Analyse der Krise des Glaubens und der Glaubensweitergabe folgt von selbst die Glaubenstherapie, in der aufgezeigt wird, welche wesentlichen Inhalte bei der Glaubensweitergabe aufgenommen und vertieft werden müssen, nämlich die Frage nach Gott und das Christusbekenntnis. Diese Prioritätenordnung hat Papst Benedikt XVI. mit den klaren Worten ausgesprochen: „In unserer Zeit, in der der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und den Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, der am Sinai gesprochen hat; zu dem Gott, dessen Gesicht wir in der Liebe bis zum Ende (Joh 13, 1) – im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus erkennen… Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und des Petrusnachfolgers in dieser Zeit.“[15]
Damit ist kondensiert zusammengefasst, worum es bei der Neuen Evangelisierung und bei der Glaubensweitergabe zu gehen hat. In ihrem Mittelpunkt muss die Frage nach Gott stehen, weil nur sie Antwort geben kann auf jene Glaubenskrise in der heutigen Kirche und Gesellschaft, die ihre radikalste Zuspitzung in der Krise des Gottesglaubens findet. Bei der Glaubensweitergabe muss in neuer Weise wahrgenommen werden können, dass das Christentum in seinem innersten Kern Glaube an Gott und das Leben einer persönlichen Beziehung mit ihm ist und dass alles Andere daraus folgt. Für Papst Benedikt XVI. ist der christliche Glaube vor allem Glaube an Gott: „Im Christentum geht es nicht um ein riesiges Gepäck von disparaten Sachen, sondern alles, was das Glaubensbekenntnis sagt und was die Glaubensentwicklung entfaltet hat, ist doch nur da, um uns das Gesicht Gottes deutlicher zu machen.“[16]
Die Zentralität Gottes in allem Denken und Tun des Christen und der Kirche muss ganz neu erscheinen. Deshalb besteht die Glaubensweitergabe vor allem darin, Gott zu den Menschen zu tragen und sie in eine persönliche Gottesbeziehung hinein zu begleiten, und zwar in der Überzeugung, dass derjenige dem Menschen nicht genug gibt, der ihm nicht Gott gibt, auch wenn er ihm ansonsten Vieles darreicht. Denn Gott wird nur dort wirklich verkündet, wo der Mensch in eine Beziehung mit Ihm eingeführt wird, und dies bedeutet vor allem, dass er das Beten lernt. Nur wo das Reden von Gott und das Reden mit Gott unlösbar miteinander verbunden sind, vermag sich auch die Evidenz zu zeigen, dass Gott existiert.
Diese Wegweisung hat Papst Benedikt XVI. nicht nur in die Katholische Kirche hinein, sondern auch in die Ökumene hinein gesprochen: „Unser erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit muss es sein, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen und damit der Welt die Antwort zu geben, die sie braucht.“[17] Zum Gottesglauben gehört von daher auch zentral das Bekenntnis zu Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Denn Christen glauben nicht einfach an irgendeinen Gott im Sinne eines höchsten Wesens jenseits der Welt. Sie bekennen sich vielmehr zu einem Gott, der mit uns Menschen in Beziehung stehen und für uns da sein will, der deshalb nicht stumm ist, sondern spricht, der zu seinem Volk Israel gesprochen hat und sich in endgültiger Weise in seinem Sohn Jesus von Nazareth mitgeteilt und sein wahres Gesicht gezeigt hat.
In der Person Jesus Christus findet Papst Benedikt XVI. denn auch die überzeugendste Antwort auf den Deismus. Nur in und durch Jesus Christus wird Gott uns wirklich konkret: „Christus ist der Immanuel, der Gott-mit-uns, die Konkretisierung des <Ich bin>.“[18] Im christlichen Glauben ist Gott nicht ein weltferner Gott und auch nicht einfach eine philosophische Hypothese über den Ursprung der Welt, sondern Gott, der uns sein Gesicht gezeigt und in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist. Mit der Überzeugung, dass uns in der Menschwerdung des göttlichen Logos die Wahrheit, die Gott selbst ist, als Person begegnet, steht oder fällt der christliche Glaube. Nur wenn der christliche Glaube wahr ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist und Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und so Anteil hat an der ewigen Gegenwart Gottes, die alle Zeiten umgreift, kann Jesus Christus nicht nur gestern, sondern auch heute die Wahrheit Gottes und der Erlöser der Menschen sein.
In der heutigen Glaubenssituation erblickt Papst Benedikt XVI. das dringende Gebot bei der Glaubensweitergabe darin, Jesus Christus in seiner ganzen Grösse wieder neu sehen zu lernen. Die wichtigste Aufgabe, vor der die Neue Evangelisierung heute steht, liegt in der Erneuerung der Christologie, die den Mut aufbringen muss, „Christus in seiner ganzen Grösse zu sehen, wie ihn die vier Evangelien in ihrer spannungsvollen Einheit zeigen“[19]. In diesem Herzensanliegen ist es auch begründet, dass Papst Benedikt XVI. der aufreibenden Anstrengung seines petrinischen Dienstes Zeit und Kraft abgerungen hat, um sein Buch über Jesus von Nazareth zu schreiben, mit dem er den Leser dazu bewegen will, sein Herz zu öffnen für die Entscheidung, Jesus Christus ganz zu folgen. Denn nur seinen hohen Anspruch annehmend und ihm nachfolgend können wir erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Nur theologische Erkenntnis, die ins Leben des Glaubens übersetzt wird, kann das Ziel der Glaubensweitergabe sein.
4. Glaubensweitergabe in den kirchlichen Grundfunktionen
Die Zentralität der Gottesfrage und die Christozentrik sind die elementaren Inhalte, um deren Verkündigung es bei der heute notwendigen Neuevangelisierung und Glaubensweitergabe als ihrer Voraussetzung gehen muss und die zusammenfliessen in der Revitalisierung der christlichen Hoffnung auf das ewige Leben. Die Glaubensweitergabe kann dabei nicht einfach als ein vereinzelter Vollzug in der Kirche betrachtet werden, sondern muss in den wesentlichen kirchlichen Grundfunktionen der Martyria, Leiturgia, Diakonia und Koinonia verwirklicht werden.
a) Martyria: den Glauben verkünden
Im Blick auf die Martyria, die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi geht es Joseph Ratzinger darum, dass bei der Glaubensweitergabe die elementaren Essentials des christlichen Glaubens im Mittelpunkt stehen, dass sie sich dabei an den Glaubensquellen orientiert und das Evangelium mit seinem befreienden Zuspruch wie mit seinem herausfordernden Anspruch ernst nimmt. Denn das Evangelium kommt uns als ein Wort entgegen, das mit höchster Autorität begegnet. Diese Autorität ist bereits präsent in seinem Namen, sofern wir auf seine ursprüngliche Bedeutung blicken. Joseph Ratzinger weist daraufhin, dass das Wort „Evangelium“ in der Zeit Jesu ein elementar politisches Wort gewesen ist und zur „Politischen Theologie“ von damals gehört hat. Als „Evangelien“ wurden damals alle Erlasse des Kaisers bezeichnet, und zwar unabhängig von ihren Inhalten und damit selbst im schlechtesten Fall, in dem sie für die betroffenen Menschen keine „gute Nachricht“ enthalten haben. „Evangelium“ hiess – einfach übersetzt – „Kaiserbotschaft“; dem Wort haftete damit „etwas Majestätisches“ an und „nichts billig Gefühliges“[20].“ Frohe Botschaft“ war sie in erster Linie deshalb, weil sie vom Kaiser und damit von jenem Menschen stammte, der – angeblich - die Welt in seinen Händen hält.
In diesem gewichtigen Sinn ist auch die Botschaft Jesu Christi „Evangelium“, freilich in erster Linie nicht, weil sie uns auf Anhieb gefallen würde oder weil sie für uns vergnüglich und bequem wäre, sondern weil sie von dem kommt, der sich nicht mehr wie der Kaiser anmasst, Gott zu sein und seine Botschaften als Evangelien zu deklarieren, der vielmehr der Sohn und damit das lebendige Wort Gottes selbst ist und deshalb in seinem Evangelium den Schlüssel zur Wahrheit hat. Im Unterschied zu den Evangelien des Kaisers kommt es beim Evangelium Jesu Christi vor allem auf seinen Inhalt an, den Papst Benedikt XVI. mit diesen tiefen Worten umschrieben hat: „<Evangelium> bedeutet: Gott hat sein Schweigen gebrochen, Gott hat gesprochen, Gott ist da. Diese Tatsache als solche ist Heil: Gott kennt uns, Gott liebt uns, er ist in die Geschichte eingetreten.“[21]
Damit dieser frohe Ernst des Evangeliums bei der Glaubensweitergabe zum Tragen kommen kann, hat sich Joseph Ratzinger ein Leben lang darum gesorgt, dass das Evangelium nicht einfach wie ein Wort aus der Vergangenheit betrachtet und verkündet wird, sondern als ein lebendiges Wort, das in die Gegenwart hinein spricht. Er hat sich deshalb für ein gesundes Gleichgewicht zwischen der historisch-kritischen Exegese und der dogmatischen Schriftauslegung eingesetzt. Auf der einen Seite braucht die Kirche die historisch-kritische Exegese, da die Heilige Schrift von geschichtlichen Ereignissen und Deutungen handelt und damit Geschichte und keinen Mythos erzählt. Auf der anderen Seite aber darf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift nicht in die Vergangenheit der Geschichte eingeschlossen werden, weil es lebendiges Wort Gottes ist, das sich an die Menschen in jeder Zeit adressiert; und dies zu bezeugen ist die Aufgabe der dogmatischen Schriftauslegung. Nur wenn die Verkündigung jenes Wort bedenkt und weitergibt, das zwar aus der Vergangenheit her kommt, aber für jede Gegenwart bestimmt ist, kann authentische Glaubensweitergabe geschehen.
b) Leiturgia: den Glauben feiern
Die Heilige Schrift nicht als ein Wort der Vergangenheit wahrzunehmen, sondern auch und vor allem als ein lebendiges und gegenwärtig aktuelles Wort, dies geschieht in erster Linie in der Liturgie der Kirche: „In der Liturgie wird die Heilige Schrift Gegenwart, sie wird Realität von heute: Es ist nicht mehr eine Schrift von vor 2000 Jahren, sondern sie muss gefeiert, verwirklicht werden.“[22] Die Liturgie ist der primäre und privilegierte Ort der Glaubensweitergabe, weil sie nicht nur im Reden von Gott, sondern in allererster Linie im Reden zu Gott geschieht, nämlich im liturgischen Lob des Dreieinen Gottes.
Wie die Liturgie der Kirche der Glaubensweitergabe authentisch dienen kann, verdeutlicht Joseph Ratzinger mit einer alten Legende über den Ursprung des Christentums in Russland. Diese Legende weiss zu berichten, Fürst Wladimir von Kiew sei auf der Suche nach der rechten Religion für sein Volk gewesen. Der Reihe nach hätten sich deshalb die aus Bulgarien kommenden Vertreter des Islam und des Judentums und Abgesandte des Papstes aus Deutschland vorgestellt, die ihm jeweils ihren Glauben als den rechten und besten angeboten hätten. Bei allen diesen Angeboten sei der Fürst jedoch unbefriedigt geblieben. Die Entscheidung sei erst gefallen, als seine Gesandten von einem feierlichen Gottesdienst zurückgekehrt seien, an dem sie in der Sophienkirche in Konstantinopel teilgenommen hätten. Voller Begeisterung hätten sie dabei dem Fürsten das Folgende berichtet: „Und wir kamen zu den Griechen und wurden dorthin geführt, wo sie ihrem Gott dienen… Wir wissen nicht, ob wir im Himmel oder auf Erden gewesen sind… Wir haben erfahren, dass Gott dort unter den Menschen weilt.“[23]
Die Wahrheit dieser Legende nimmt Joseph Ratzinger darin wahr, dass die innere Kraft der Liturgie „in der Ausbreitung des Christentums ohne Zweifel eine wesentliche Rolle gespielt“ har[24], die man nicht unterschätzen sollte. Dies trifft in besonderer Weise auf die Byzantinische Liturgie zu, die die frommen Besucher und Gottsucher in den Himmel versetzt hat, wiewohl sie gerade nicht missionarisch ausgerichtet ist. Sie war und ist nicht werbende Interpretation des Glaubens nach aussen an die Nichtglaubenden, sondern sie war und ist ganz im Inneren des Glaubens angesiedelt. Doch gerade in dieser nicht-missionarischen Zweckfreiheit hat sie immer wieder Gott-suchende Menschen angezogen und glaubwürdig auf sie eingewirkt. Es ist das selbstlose Stehen der Glaubenden vor Gott und das Schauen auf Ihn, die das Licht Gottes in der liturgischen Feier auch den Aussenstehenden spürbar werden lassen. Die Liturgie verliert umgekehrt dort ihre Ausstrahlungskraft, wo sie unvermittelt missionarisch sein will und diesen Zweck mit katechetisch belehrenden Elementen versieht. Dann jedoch wird die Liturgie vor allem für die Menschen gemacht und folgt nicht mehr der elementaren Sinnbestimmung, Gott zu gefallen, wie der heilige Paulus in seinem Brief an die Römer dies wünscht (12, 1). Doch genau dies suchen heute viele Menschen, die sich danach sehnen, in der Liturgie das Geheimnis Gottes zu erfahren. In dieser unmissionarischen Zweckfreiheit dient die Liturgie der Glaubensweitergabe am adäquatesten.
Vor diesem weiteren Hintergrund verstehen wir auch, dass die Kirche die heilige Theresia von Lisieux – neben dem heiligen Franz Xaver - zur Patronin der Mission erwählt hat. Auf den ersten Blick erscheint dies wenig verständlich, denn diese Heilige hat nie ein Missionsland betreten und hat nicht unmittelbar missionarische Aktivitäten ausgeübt. Sie hat aber missionarisch gewirkt, indem sie im eucharistischen Herz der Kirche die ganze Welt vor Gott getragen und für sie gebetet hat. In dieser Weise hat sie gelebt, wie sich glaubwürdige Mission vollzieht.
c) Diakonia: den Glauben erfahrbar machen
Die Liturgie der Kirche ist nicht direkt missionarisch, aber sie mündet in die Sendung, wie vor allem am Schluss der Eucharistiefeier deutlich ausgesprochen wird. In der frühen Kirche wurde die Eucharistie sehr oft einfach als „Friede“ bezeichnet; „Pax“ ist sehr bald einer der Namen des eucharistischen Sakramentes geworden. Denn die Eucharistie eröffnet und schenkt einen Lebensraum des Friedens: Sie ist Friede vom auferstandenen Herrn her, wie es mit dem Friedensgruss zum Ausdruck gebracht wird. Der Friede, den Christus in der Eucharistie schenkt, ist aber dazu bestimmt, dass er weitergegeben wird. Wer das grossartige Geschenk des Friedens in der Feier der Eucharistie von Christus empfangen darf, ist dann auch in die Pflicht genommen, den Frieden Christi in die Welt zu tragen und ihm so zu dienen, dass er in der heutigen Welt eine Chance bekommt. Der Friedensgruss mündet deshalb am Ende der Eucharistiefeier in die Friedenssendung: „Gehet hin in Frieden!“
In der lateinischen Form der Heiligen Messe lautet diese Sendung; „Ite missa est“. In der vorchristlichen Verwendung wurde mit dieser Formel zum Ausdruck gebracht, dass eine Versammlung beendet ist. In der christlichen Liturgie sagt dieses Wort jedoch nicht nur „Entlassung“, sondern vor allem „Entsendung“[25], Auftrag zur Mission im Alltag des Lebens, vor allem in Caritas und Diakonie. Diesem Thema hat Papst Benedikt XVI. den zweiten Teil seiner ersten Enzyklika über die christliche Liebe „Deus caritas est“ gewidmet und dabei hervorgehoben, dass Liebe zu üben für die Witwen und Waisen, für die Gefangenen, Kranken und Notleidenden genau so zum Wesen der Kirche gehört „wie der Dienst der Sakramente und der Verkündigung des Evangeliums“ und dass deshalb die Kirche „den Liebesdienst so wenig ausfallen lassen kann wie Sakrament und Wort“[26]. Noch deutlicher betont Papst Benedikt XVI. dies bei seiner Interpretation der Einsetzungsworte Jesu: „<Caritas>, die Sorge um den anderen, ist nicht ein zweiter Sektor des Christentums neben dem Kult, sondern in diesem selber verankert und ihm zugehörig“. Denn „Horizontale und Vertikale sind in der Eucharistie, im <Brotbrechen> untrennbar verbunden.“[27]
Man darf mit bestem Recht urteilen, dass Caritas und Diakonie noch nie eine derart tiefe lehramtliche Würdigung erhalten haben wie in der Enzyklika von Papst Benedikt XVI. Denn er ist überzeugt, dass die Kirche die Liebe, die sie von Gott geschenkt erhält und die Gott selbst ist, an die Menschen weitergeben muss. Dass in dieser Grundhaltung Diakonie und Caritas in besonderer Weise auch im Dienst der Glaubensweitergabe stehen, hat Papst Benedikt XVI. am Beispiel von Kaiser Julian, dem Apostaten verdeutlicht. Er hat das Heidentum, die alte römische Religion wieder herstellen und zugleich Anleihen vom Christentum machen wollen, wie er in einem Brief geschrieben hat, das Einzige, was ihn am Christentum beeindrucke, sei die Liebestätigkeit der Kirche.[28]
d) Koinonia: den Glauben gemeinsam leben
Mit diesem Beispiel kommt zugleich an den Tag, dass nicht nur die drei Grundfunktionen der Martyria, Leiturgia und Diakonia im Dienst der Glaubensweitergabe stehen, sondern auch die Koinonia der Kirche selbst. Denn die Neue Evangelisierung und die Glaubensweitergabe sind „nicht einfach eine Form des Redens, sondern eine Form des Lebens“[29] und benötigen deshalb die Glaubensgemeinschaft der Kirche. Papst Benedikt XVI. bezeichnet sie vor allem als „Weggemeinschaft des Glaubens“, und zwar im Anschluss an die früheste Bezeichnung der Kirche in der Apostelgeschichte, in der der christliche Glaube „Weg“ und die Christen, die Jesus Christus als „Weg“ nachfolgen, „Anhänger des Weges“ (Apg 9, 2) genannt werden. Die Kirche ist deshalb der gemeinsame Weg der Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, der sich selbst als „Weg“ offenbart und genannt hat, genauer „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14. 5).
Damit ist deutlich, dass es christlich gesehen ohne Kirche keinen Glauben und deshalb auch keine Glaubensweitergabe geben kann. Glaube richtet sich „nicht nur frontal auf das Du Gottes und Christi, sondern diese dem Menschen an sich unzugängliche Berührung erschliesst sich in der Kommunion mit denen, denen er sich selbst kommuniziert hat.“[30] Die Kirche als ganze steht deshalb nur dann im Dienst der Glaubensweitergabe, wenn sie nicht nur das Wort Gottes verkündet, sondern selbst ein Lebensort Gottes ist, so dass die Menschen erfahren können, dass es die Kirche „um Gottes willen“ gibt. Die Kirche ist kein Zweck in sich selbst, sondern ist dazu da, „damit Gott gesehen wird“ und damit „ein Ausblick auf Gott entsteht“[31]. Glaubensweitergabe bedeutet deshalb immer auch mystagogische Einführung in das Geheimnis der Kirche und gläubige Vertiefung der Kirchengliedschaft.
Von daher verstehen wir auch, dass Kardinal Joseph Ratzinger als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre viel Zeit und Energie bei der Erarbeitung und Veröffentlichung des „Katechismus der Katholischen Kirche“ investiert hat. Der Katechismus besteht aus vier Hauptstücken, die sich aus den grundlegenden Lebensvollzügen der Kirche ergeben, nämlich dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, den Sakramenten, dem Dekalog und dem Gebet des Herrn. Der Katechismus zeigt somit an, was einen Christen in der Glaubensgemeinschaft der Kirche ausmacht: Um Christ als Glied der Kirche zu werden und zu sein, ist es notwendig zu lernen, was es heisst zu glauben, muss man sich in die Mysterien der christlichen Kirche, nämlich in ihren Gottesdienst einleben, muss man die christliche Weise des Lebens, gleichsam den christlichen Lebensstil erlernen, und muss man zu beten vermögen. Den Glauben bekennen, feiern, verwirklichen und beten sind hervorragende Wege der Glaubensweitergabe auch in der heutigen Zeit.
Der Katechismus ist dabei vor allem der wachen Sorge verpflichtet, dass der Glaube ursprungstreu weitergegeben wird, dass nur das überliefert wird, was die Kirche von Gott empfangen hat, wie es der heilige Paulus prägnant zum Ausdruck bringt: „Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe“ (1 Kor 11, 23). Mit diesen Worten umschreibt Paulus im Ersten Brief an die Korinther seine Verantwortung bei der Verkündigung der grundlegenden Elemente der christlichen Überlieferung, die sich auf die Auferstehung Jesu Christi und die Feier der Eucharistie beziehen. Paulus ist sich voll bewusst, dass er das Entscheidende des christlichen Glaubens nicht selbst erdacht oder erfunden, sondern dass er es empfangen hat und dass er nur das Empfangene weitergeben kann.
5. Wegweisungen für die Glaubensweitergabe
Von daher ist auch nach Wegen der Glaubensvermittlung in der Sicht von Joseph Ratzinger zu fragen. An erster Stelle dürfte deutlich geworden sein, dass die Glaubensweitergabe Joseph Ratzinger deshalb so sehr am Herzen lag, weil sie mit dem Hauptthema seines theologischen Denkens und päpstlichen Wirkens engstens verbunden ist, nämlich der Liebe Gottes und der Liebe der Menschen. Bereits in seinen „Überlegungen zur theologischen Grundlage der Sendung der Kirche“, die er für die Sitzung in Nemi zur Vorbereitung einer konziliaren Erklärung über die Missionstätigkeit der Kirche erarbeitet hat, hat er als Grundsatz formuliert: „<Sendung> ist Liebe, die sich selbst anderen hingibt, wie Gott seinen Sohn den Menschen <hingab> und dieser selbst sich <hingab>.“ Denn Sendung ist „nicht eine Art Eroberungsunternehmen“, sondern sie ist in erster Linie „Zeugnis für die Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist.“[32] Sendung, die in ihrer Mitte die Botschaft der Liebe Gottes trägt, kann nur in Liebe wahrgenommen werden.
Der christliche Gottesgedanke hat für Joseph Ratzinger stets zwei Seiten: Gott ist Liebe und Vernunft, Caritas und Logos. Die christliche Botschaft der Liebe muss deshalb auch intellektuell durchdacht und verantwortet werden, um die Menschen berühren zu können. Das lebenslange Suchen nach einer glaubwürdigen Synthese von Glaube und Vernunft stand bei Joseph Ratzinger von daher ebenfalls im Dienst der Glaubensvermittlung, wie er bereits in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Bonn über „Den Gott des Glaubens und den Gott der Philosophen“ im Jahre 1959 eindringlich betont hat: „Wenn es der christlichen Botschaft wesentlich ist, nicht esoterische Geheimlehre für einen eng beschränkten Zirkel von Eingeweihten, sondern Botschaft Gottes an alle zu sein, dann ist ihm auch die Dolmetschung nach aussen wesentlich, in die allgemeine Sprache der menschlichen Vernunft hinein.“[33] Und als Papst hat er von einem „intelligenten Feuer“, von einer „sobris ebrietas“ gesprochen, die für die Glaubensweitergabe charakteristisch sein muss[34].
Gott als Liebe und Vernunft kann den Menschen aber nur nahe gebracht werden, wenn die Glaubensweitergabe ein durch und durch freiheitlicher Vorgang ist, der sich an die Freiheit anderer Menschen adressiert, ohne ihnen etwas aufdrängen zu wollen. Christliche Glaubensweitergabe ist die freiheitliche Einladung an die Freiheit der Menschen, Kommunikation aufzunehmen und in einen belebenden Dialog einzutreten. Die Glaubensweitergabe drängt deshalb niemandem den Glauben auf, wie Papst Benedikt XVI. in seiner Predigt in München im Jahre 2006 eindringlich betont hat; „Der Glaube kann nur in Freiheit geschehen. Aber die Freiheit der Menschen, die rufen wir an, sich für Gott aufzutun; ihn zu suchen; ihm Gehör zu schenken.“[35] Dem Christlichen ist deshalb jede Art von Proselytismus zuwider; die Glaubensweitergabe geschieht vielmehr durch Anziehung: „Wie Christus mit der Kraft seiner Liebe, die im Opfer am Kreuz gipfelt, alle an sich zieht, so erfüllt die Kirche ihre Sendung in dem Mass, in dem sie, mit Christus vereint, jedes Werk in geistlicher und konkreter Übereinstimmung mit der Liebe ihres Herrn erfüllt.“[36]
Damit die Kirche selbst ihre Sendung der Glaubensweitergabe in wirklicher Freiheit vollziehen kann, hat Papst Benedikt XVI. der Kirche eine notwendige und tiefgreifende „Entweltlichung“ zugemutet.[37] Er ist dabei überzeugt gewesen, dass die Kirche zu einer solchen Entweltlichung oft von aussen verholfen worden ist, beispielsweise durch die verschiedenen Epochen der Säkularisierung, die zur Streichung von Privilegien und zur Enteignung von Kirchengütern geführt und der Kirche wieder das Gesicht weltlicher Armut gegeben haben. Das Postulat der Entweltlichung impliziert dabei keineswegs einen Rückzug aus der Welt, sondern bedeutet im Gegenteil die Vorsorge dafür, dass das missiomarische Zeugnis der Kirche glaubwürdig wahrgenommen werden kann, wie Papst Benedikt XVI. ausdrücklich hervorhebt: „Das missionarische Zeugnis der entweltlichten Kirche tritt klarer zutage. Die von materiellen und politischen Lasten und Privilegien befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben.“[38]
Von daher verstehen wir auch, dass für den Weg der Glaubensweitergabe die Methode Gottes gelten muss, die Joseph Ratzinger im Gleichnis vom Senfkorn wahrnimmt. Das Senfkorn ist das kleinste von allen Samenkörnern; es wird aber grösser als alle anderen Gewächse, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können (vgl. Mk 4, 30-32). Das Gleichnis wäre freilich völlig missverstanden, wenn angesichts der Sendung der Kirche, das christliche Evangelium in die ganze Welt hinaus zu tragen, die Deutung des Gleichnisses in die Versuchung grosser Ungeduld führen würde, genauer in die Versuchung, bei der Glaubensweitergabe das Senfkorn zu vergessen und sofort den gewachsenen Baum und damit den grossen Erfolg und die eindrücklichen Zahlen zu suchen. Wie aber in der Geschichte des Heils die Kirche immer zugleich ein grosser Baum und ein winziges Senfkorn ist, so muss auch die Glaubensweitergabe im Licht des Geheimnisses des Senfkorns geschehen: „Gott rechnet nicht mit grossen Zahlen; äussere Macht ist kein Zeichen seiner Gegenwart.“[39] Die grossen Dinge beginnen bei Gott vielmehr immer im Kleinen. Deshalb dient auch die Glaubensweitergabe nicht der Zähl-Sorge, sondern der Heils-Sorge.
6. Freude als Notenschlüssel der Glaubensweitergabe
Damit kommen wir zur entscheidenden Wegweisung Joseph Ratzingers für die Glaubensweitergabe: Die missionarische Dynamik lebt nur, wenn sie aus Freude am Evangelium entsteht und davon Zeugnis gibt, und zwar aufgrund des echten Wunsches, das unschätzbare Geschenk, das Gott uns selbst gemacht hat, mit anderen Menschen zu teilen. Die Freude ist der zentrale Inhalt der Botschaft Gottes. Die Freude steckt nicht nur im Wort „Evangelium“, sondern sie steckt auch alle an, die auf das Evangelium Jesu Christi hören, es verkünden und leben. Die Freude am Evangelium zu verkünden ist deshalb die wichtigste Sendung der heutigen Christenheit, wie Papst Benedikt XVI. immer wieder in Erinnerung gerufen hat: „Die Freude an Gott, die Freude an Gottes Offenbarung, an der Freundschaft mit Gott wieder zu erwecken, scheint mir eine vordingliche Aufgabe der Kirche in unserem Jahrhundert. Gerade auch für uns gilt das Wort, das der Priester Esra dem ein wenig mutlos gewordenen Volk nach der Verbannung zurief: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke (Neh 8, 10).“[40]
Die Freude ist der innerste Antrieb der Glaubensweitergabe. Er lässt sich wohl am einfachsten mit einer Weisheit des Volksmundes verdeutlichen, die besagt: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“ Diese Wahrheit kennen wir aus eigener Erfahrung: Wenn Menschen etwas sehr Schönes erlebt haben, wenn sie beispielsweise von bereichernden Ferien nach Hause gekommen sind, dann braucht man sie nicht erst aufzufordern, davon zu erzählen, was sie erlebt haben; sie werden es vielmehr von sich aus tun, um den anderen Anteil zu geben an dem, was sie erfahren haben. „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“: Diese Wahrheit gilt erst recht für den christlichen Glauben, sofern er das Herz der Christen erfüllt, so dass sie von selbst beginnen, das Evangelium zu verkünden und die Freude weiterzugeben, von der sie selbst erfüllt sind. Glaubensweitergabe ist deshalb nicht einfach eine Pflicht, sondern die Dynamik des erfahrenen Glaubens selbst: „Wer Jesus gesehen hat, wer ihm begegnet ist, muss zu den Freunden eilen und ihnen sagen: <Wir haben ihn gefunden, es ist Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist>.“[41]
Die Glaubensweitergabe geschieht heute vor allem durch das persönliche Glaubenszeugnis, gleichsam durch „Mund-zu-Mund-Beatmung“. Sie geschieht heute nicht so sehr durch konsumfreundliche Werbung oder durch die Verbreitung von viel Papier und auch nicht in den Medien. Das entscheidende Medium der Ausstrahlung Gottes sind die Christen selbst, die ihren Glauben glaubwürdig leben und so dem Evangelium ein persönliches Gesicht geben. Wenn uns Jesus Christus als Licht der Welt wirklich einleuchtet, werden wir von selbst ausstrahlen, Christen mit Ausstrahlung sein, die gleichsam wie finnische Kerzen leben, die bekanntlich von innen nach aussen brennen und so Licht geben.
Die Glaubensweitergabe braucht getaufte Menschen, deren Herz von Gott erfüllt und deren Vernunft vom Licht Gottes erleuchtet ist, so dass ihr Herz die Herzen anderer berühren und die Vernunft zur Vernunft anderer sprechen können. Oder wie Joseph Ratzinger beim Besuch im Zentrum „Ad gentes“ in Nemi das Hauptziel der Sendung der Kirche beschrieben hat: Es besteht in der „Dynamik der Notwendigkeit, das Licht des Wortes Gottes, das Licht der Liebe Gottes in die Welt zu tragen und durch diese Verkündigung neue Freude zu schenken.“[42] Darin bestehen in der Sicht der Theologie und Verkündigung von Joseph Ratzinger-Benedikt XVI. Inspiration und Aufbruch für die Sendung der Kirche auch heute.
[1] Benedikt XVI., Ansprache beim Besuch des Zentrums „Ad gentes“ der Steyler-Missionare in Nemi am 9. Juli 2012.
[2] Ad gentes, Nr. 9.
[3] Vgl. J. Ratzinger, Konzilsaussagen über die Mission ausserhalb des Missionsdekretes, in: JRGS 7/2, 919-951.
[4] J. Ratzinger, Weltoffene Kirche? Überlegungen zur Struktur des Zweiten Vatikanischen Konzils, in: JRGS 7/2, 980-1002, zit. 1001.
[5] Vgl. Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione (ed.), Enchiridion della nuova evangelizzazione. Testi del Magistero pontificio e conciliare 1939-2012 (Città del Vaticano 2012).
[6] Benedikt XVI., Predigt in der Heiligen Messe beim Abschluss der Bischofssynode am 28. Oktober 2012.
[7] Benedikt XVI., Motu proprio „Ubicumque et semper“.
[8] Benedikt XVI., Motu proprio „Porta fidei“, Nr. 2.
[9] Benedikt XVI., Predigt in der Ersten Vesper am Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus am 28. Juni 2010.
[10] J. Ratzinger, Vorwort zu: Dogma und Verkündigung, in: JRGS 9/2, 849.
[11] J. Ratzinger, Steht der Katechismus der Katholischen Kirche auf der Höhe der Zeit? Überlegungen zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung, in: JRGS 9/2, 1065-1083, zit. 1065 und 1067.
[12] J. Ratzinger, Die neuen Heiden und die Kirche, in: JRGS 8/2, 1143-1158, zit, 1143.
[13] J. Ratzinger, Aktuelle Probleme der Theologie – Konsequenzen für die Katechese, in: JRGS 9/2, 979-987, zit. 982.
[14] Ebda., 979.
[15] Benedikt XVI., Brief an die Bischöfe der katholischen Kirche in Sachen Aufhebung der Exkommunikation der vier von Erzbischof Lefebvre geweihten Bischöfe (10. März 2009).
[16] Benedikt XVI., Ansprache an die Schweizer Bischöfe beim Ad Limina-Besuch am 7. November 2006.
[17] Benedikt XVI., Ansprache im Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche des Augustinerklosters Erfurt am 23. September 2011.
[18] J. Ratzinger, Die Neuevangelisierung, in: JRGS 8/2, 1231-1242, zit. 1240.
[19] J. Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorwort zur Neuausgabe, 2000, in: JRGS 4, 38-53, zit. 52.
[20] K. Kardinal Ratzinger. Glauben als Vertrauen und Freude – Evangelium, in: Ders. Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (München 1982) 78-87, zit. 82.
[21] Benedikt XVI., Meditation bei der ersten Generalkongregation der XIII. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode am 8. Oktober 2012.
[22] Pressekonferenz mit Papst Benedikt XVI. auf dem Flug nach Spanien am 6. November 2010.
[23] J. Ratzinger, Eucharistie und Mission, in: JRGS 11, 397-423, zit. 397.
[24] Ebda., 398.
[25] Benedikt XVI., Ansprache nach dem Mittagessen mit den Synodenvätern am 22. Oktober 2006.
[26] Benedikt XVI., Deus caritas est, Nr. 22.
[27] J. Ratzinger, Jesus von Nazareth. Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, in: JRGS 6/1, 417-635, zit. 515-516.
[28] Benedikt XVI., Deus caritas est, Nr. 24.
[29] J. Ratzinger, Die Neuevangelisierung, in: JRGS 8/2, 1231-1242, zit. 1234.
[30] J. Ratzinger, Glaubensvermittlung und Glaubensquellen, in: JRGS 9/2, 929-950, zit. 940.
[31] J. Ratzinger, Salz der Erde, in: JRGS 13/1, 207-458, zit. 268.
[32] J. Ratzinger, Überlegungen zur theologischen Grundlage der Sendung (Mission) der Kirche, in: JRGS 7/1, 223-235, zit. 225.
[33] J. Ratzinger, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen- Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis, in: JRGS 3/1, 189-210, zit. 208.
[34] Benedikt XVI., Meditation bei der ersten Generalkongregation der XIII. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode am 9. Oktober 2012.
[35] Benedikt XVI., Predigt in der Eucharistiefeier auf dem Freigelände der Neuen Messe bei München-Riem am 10. September 2006.
[36] Benedikt XVI., Predigt in der Eucharistiefeier zur Eröffnung der V. Generalversammlung der Bischöfe von Lateinamerika und der Karibik auf dem Vorplatz des Nationalheiligtums in Aparecida am 13. Mai 2007.
[37] Vgl. K. Kardinal Koch, Entweltlichung und Neuevangelisierung: Gegensatz oder Synthese? Theologische Perspektiven von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI., in: G. Gänswein (Hrsg.), Fides et ratio im Denken und Wirken Benedikts XVI. = Ratzinger-Studien. Band 23 (Regensburg 2022) 101-121.
[38] Benedikt XVI., Ansprache bei der Begegnung mit in Kirche und Gesellschaft engagierten Katholiken im Konzerthaus in Freiburg im Breisgau am 25. September 2011.
[39] J. Ratzinger, Die Neuevangelisierung, in: JRGS 8/2, 1231-1242, zit. 1233.
[40] J. Ratzinger, Die Kirche an der Schwelle des 3. Jahrtausend, in: JRGS 8/2, 1243-1254, zit. 1254.
[41] Benedikt XVI., Ansprache im Päpstlichen Römischen Priesterseminar am 12. Februar 2010.
[42] Benedikt XVI., Ansprache beim Besuch im Zentrum „Ad Gentes“ der Steyler-Missionare in Nemi am 9. Juli 2012.