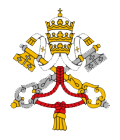Vortrag beim X. Oekumenischen Bekentniskongress der IKBG/ICN
zum Thema "Bleiben im Glauber der Alten Kirche"
Horgeismar, den 31. August 2024
DAS NICAENUM ALS GRUNDLAGE GEISTLICHER ÖKUMENE
1. Ein gemeinchristliches Bekenntnis zu Jesus Christus
Die zum Ersten Ökumenischen Konzil in Nicaea im Jahre 325 versammelten Bischöfe haben in ihrer „Erklärung der 318 Väter“ den „einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, geboren aus dem Vater als Einziggeborener, das heisst aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, geboren, nicht geschaffen, wesensgleich mit dem Vater, durch den alles geworden ist im Himmel und auf der Erde“ bekannt; und im Brief der Synode an die Ägypter haben sie mitgeteilt, der allererste Untersuchungsgegenstand sei die „Glaubensfeindschaft und Gesetzwidrigkeit des Arius und seiner Anhänger“ gewesen und sie hätten deshalb einstimmig beschlossen, „seine glaubensfeindliche Lehrmeinung sowie seine blasphemischen Aussagen und Bezeichnungen, mit deren Hilfe er den Sohn Gottes schmähte, mit dem Anathem zu belegen“[1].
Mit diesen Aussagen ist der Hintergrund des vom Konzil formulierten Glaubensbekenntnisses zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes, der „wesensgleich mit dem Vater“ ist, skizziert. Der Hintergrund hat in einem heftigen Streit bestanden, der in der damaligen Christenheit vor allem im östlichen Teil des Römischen Reiches entbrannt war und dokumentiert, dass am Beginn des vierten Jahrhunderts die Christusfrage zum „Problemfall des christlichen Monotheismus“ geworden ist[2]. Der Streit hat sich vor allem um die Frage gedreht, wie das christliche Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohne Gottes mit dem ebenso christlichen Glauben an einen einzigen Gott im Sinne des monotheistischen Bekenntnisses vereinbart werden kann.
Vor allem der alexandrinische Theologe Arius hat einen strengen Monotheismus in der Sinnrichtung des damaligen philosophischen Denkens vertreten und hat, um einen derart strengen Monotheismus durchzuhalten, Jesus Christus aus dem Gottesbegriff ausgeklammert. In dieser Sicht kann Christus nicht im eigentlichen Sinn „Sohn Gottes“ sein, sondern nur ein Mittelwesen, dessen sich Gott bei der Erschaffung der Welt und bei seinen Beziehungen zu den Menschen bedient. In dem damit entbrannten Streit um das Christusbekenntnis hat Kaiser Konstantin eine grosse Gefahr für seinen Plan wahrgenommen, die Einheit des Reiches auf dem Fundament der Einheit des christlichen Glaubens zu festigen; er hat sein politisches Anliegen aber auf einem kirchlich-theologischen Wege lösen wollen. Um die damals einander bekämpfenden Gruppierungen zu versöhnen, hat der Kaiser das Erste Ökumenische Konzil in die kleinasiatische Stadt Nicaea in der Nähe der Kaiserresidenz Nikomedia einberufen. Dieses Konzil hat das von Arius propagierte Modell eines strikt philosophischen Monotheismus mit dem Glaubensbekenntnis zurückgewiesen, dass Jesus Christus als Sohn Gottes „wesensgleich mit dem Vater“ ist.
Das christologische Bekenntnis von Nicaea ist zur Grundlage des gemeinsamen christlichen Glaubens geworden, zumal das Konzil von Nicaea in einer Zeit stattgefunden hat, in der die Christenheit noch nicht von den vielen späteren Spaltungen verwundet gewesen ist. Es kann deshalb in seiner ökumenischen Bedeutung nicht überschätzt werden. Es ist nicht nur den Orientalischen und Orthodoxen Kirchen und der Katholischen Kirche, sondern auch den aus den Reformationen hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften gemeinsam, wie auch und gerade die Confessio Augustana im Jahre 1530 belegt, die sich ganz in den Konzilsentscheidungen der frühen Kirche verwurzelt sieht und deshalb für sich in Anspruch nimmt, dass in diesem Bekenntnis nichts enthalten ist, „was abweicht von der Heiligen Schrift und von der allgemeinen und der römischen Kirche, wie wir sie aus den Kirchenschriftstellern kennen“[3]. Das Glaubensbekenntnis von Nicaea ist vor allem deshalb von grundlegender ökumenischer Bedeutung, da für die Wiedergewinnung der Einheit der Kirche die Übereinstimmung im wesentlichen Inhalt des Glaubens erforderlich ist, und zwar nicht nur zwischen den heutigen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, sondern auch die Übereinstimmung mit der Kirche der Vergangenheit und vor allem mit ihrem apostolischen Ursprung. Von daher ist es ein Gebot der ökumenischen Stunde, dass das 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nicaea von allen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gemeinsam begangen und sein christologisches Glaubensbekenntnis erneut angeeignet wird.[4]
2. Grundlage Geistlicher Ökumene
Das Christusbekenntnis des Konzils von Nicaea bildet genauer das Fundament einer geistlichen Ökumene. Dabei handelt es sich freilich um einen Pleonasmus. Denn christliche Ökumene ist entweder geistlich oder sie ist nicht. Dies zeigt sich bereits am Beginn der Ökumenischen Bewegung, an dem die Einführung der Gebetswoche für die Einheit der Christen gestanden hat, die ihrerseits eine ökumenische Initiative gewesen ist. Die Ökumenische Bewegung ist von Anfang an vor allem eine Gebetsbewegung gewesen. Es ist das Gebet um die Einheit der Christen gewesen, das den Weg der Ökumenischen Bewegung geöffnet hat, was Papst Benedikt XVI. mit dem anschaulichen Bild zum Ausdruck gebracht hat: „Das Schiff des Ökumenismus wäre niemals aus dem Hafen ausgelaufen, wenn es nicht von dieser umfassenden Gebetsströmung in Bewegung gesetzt und vom Wehen des Heiligen Geistes angetrieben worden wäre.“[5]
Im klaren Bewusstsein, dass in der Mitte allen ökumenischen Bemühens das Gebet um die Einheit stehen muss, hat das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils „Unitatis redintegratio“ den Geistlichen Ökumenismus als „Seele der ganzen Ökumenischen Bewegung“ bezeichnet[6]. Mit dem Gebet um die Einheit bringen wir unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass wir Menschen die Einheit nicht selbst machen und auch nicht über ihre Gestalt und ihren Zeitpunkt befinden können. Wir Menschen können Spaltungen produzieren, wie die Geschichte und auch die Gegenwart zeigen. Die Einheit können wir uns nur schenken lassen; und die beste Vorbereitung, um die Einheit als Geschenk vom Heiligen Geist empfangen zu können, ist das Gebet um die Einheit. In der Zentralität des Gebetes kommt an den Tag, dass das ökumenische Bemühen vor allem eine geistliche Aufgabe ist, die in der Überzeugung getan wird, dass der Heilige Geist das ökumenische Werk begonnen hat und es auch vollenden und uns dabei den Weg zeigen wird.
Dies gilt vor allem, wenn sich Geistliche Ökumene als Christusökumene versteht und vollzieht. Denn die Herzmitte der Ökumene besteht in der gemeinsamen Umkehr aller Christen zu Jesus Christus, in dem die Einheit bereits vor-gegeben ist. Solche Geistliche Ökumene lässt sich wohl am besten an einer Begebenheit in der geistlichen Freundschaftsgeschichte zwischen dem heiligen Franziskus von Assisi und der heiligen Klara verdeutlichen. Als sie sich wieder einmal sehen wollten, trafen sie sich an einem Bach, freilich an gegenüberliegenden Ufern. Da der Bach zu breit war, um ihn überqueren zu können, kamen sie zur Überzeugung, sie sollten auf beiden Seiten zurückgehen bis zur Quelle des Baches, auf die hin der Bach immer kleiner und enger wird. An der Quelle des Baches konnten sie sich problemlos begegnen und ihre geistliche Freundschaft feiern. Auch christliche Ökumene kann nur in glaubwürdiger Weise vorankommen, wenn wir zur Quelle des Glaubens zurückkehren, die wir nur in Jesus Christus finden können, wie ihn die Konzilsväter in Nicaea bekannt haben.
In dieser Weise entspricht christliche Ökumene am tiefsten dem Willen des allen Christen gemeinsamen Herrn, der in seinem Hohepriesterlichen Gebet um die Einheit seiner Jünger gebetet hat: „dass alle eins seien“. Bei dem Gebet Jesu fällt auf, dass Jesus seinen Jüngern die Einheit nicht befiehlt und sie auch nicht von ihnen einfordert, sondern für sie betet, und zwar mit einem an seinen himmlischen Vater gerichteten Gebet. An diesem Gebet kann man am besten ablesen, worin auch die ökumenische Suche nach Einheit im Licht des Glaubens besteht und bestehen muss.[7] Da die Einheit der Jünger das zentrale Gebetsanliegen Jesu gewesen ist, kann christliche Ökumene nur Einstimmen aller Christen in das Hohepriesterliche Gebet des Herrn sein, indem sie sich sein Herzensanliegen der Einheit zu eigen machen. Wenn Ökumene nicht einfach philantropisch und rein zwischenmenschlich, sondern wirklich christologisch motiviert und fundiert ist, kann sie nichts anderes sein als „Teilhabe am Hohepriesterlichen Gebet Jesu“[8].
3. Betende Zwiesprache mit dem Vater als Mitte der Person Jesus
Geistliche Ökumene im Sinne der Christusökumene besteht von daher darin, dass wir uns in die Gebetsbewegung Jesu hin zu seinem Vater hineinziehen lassen und unser Augenmerk darauf richten, wie Jesus gebetet hat. Dann zeigt sich, dass Jesus so sehr im Gebet und aus dem Gebet gelebt hat, dass man sagen kann, sein ganzes Leben und Wirken sei ein einziges Gebet gewesen. Seine Verkündigung, sein heilendes Wirken, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung sind in seinem Beten verankert gewesen. Papst Benedikt XVI. hat dafür das treffende Bild geprägt, das Beten Jesu durchziehe sein ganzes Leben „wie ein verborgener Kanal, der das Leben, die Beziehungen, das Handeln bewässert und ihn mit immer grösserer Entschlossenheit zur Selbsthingabe führt, gemäss dem Liebesplan Gottes, des Vaters“[9]. Ohne diese Lebenshaltung des Gebetes kann man die Gestalt Jesus nicht verstehen. Da in diesem Gebetsgeheimnis die biblische Grundlage des Christusbekenntnisses des Konzils von Nicaea besteht, ist es angezeigt, sich in dieses Geheimnis zu vertiefen.
Im Neuen Testament ist es vor allem der Evangelist Lukas, der Jesus in seinem irdischen Leben als durch und durch betenden Sohn Gottes zeichnet, dessen existenzielle Mitte die Zwiesprache mit seinem himmlischen Vater ist, mit dem er in innerster Einheit lebt, und der sich besonders bei wichtigen Weichenstellungen in seinem irdischen Leben immer wieder in das Gebet zurückzieht.[10] Indem wir uns in das Geheimnis des Betens Jesu einbergen und dies bei einigen Sequenzen im Leben Jesu verdeutlichen, ist uns auch der Weg gewiesen, auf dem wir im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, zur Einheit der Kirche wiederfinden können.
a) Berufung im Gebet: Im sechsten Kapitel des Lukasevangeliums, in dem die Erwählung der Zwölf durch Jesus berichtet wird, lesen wir als Einleitung: „In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus; sie nannte er auch Apostel“ (Lk 6, 12-13). Die grundlegende Bedeutung des Betens im Leben Jesu zeigt sich zuerst darin an, dass die Berufung der Zwölf aus der Gebetsnacht Jesu hervorgeht. Im nächtlichen Gebet nimmt Jesus bereits vorweg, was er am Tag vollziehen wird. Die einsame Zwiesprache mit seinem Vater im nächtlichen Gebet auf dem Berg erweist sich so als der theologische Ort von Berufung und Apostolat.
Diese Feststellung muss auch im heutigen Leben der Kirche und in der Ökumene zu denken geben. Denn mit der Berufung der Zwölf hat Jesus mit einer zeichenhaften und sehr realen Gebärde Kirche als Volk Gottes begründet. Die Zwölf bilden die Urzelle von Kirche und sie weisen unmissverständlich daraufhin, dass die Kirche eine vom Beten Jesu her geeinte Gemeinschaft ist. Wie die Berufung der Zwölf aus dem betenden Reden Jesu mit seinem Vater hervorgegangen und als Beginnen von Kirche zu verstehen ist, so ist auch die Kirche heute in ihrem innersten Kern eine vom Beten mit Jesus Christus her geeinte Glaubensgemeinschaft und besteht ihre erste Vorsorge für neue Berufungen in der Kirche im Gebet.
b) Bekenntnis im Gebet: Im 9. Kapitel des Lukasevangeliums lesen wir weiter: „Jesus betete einmal in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Menschen?“ (Lk 9, 18). Anschliessend stellte er ihnen persönlich die Frage: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Lk 9, 29a). Auf diese Frage antwortete bekanntlich Petrus als Sprecher der Jünger mit dem Bekenntnis, dass er der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das Christusbekenntnis des Petrus geht dabei aus dem Beten Jesu hervor und antwortet auf dieses Beten. Das Bekenntnis des Petrus ist dann zum Ursprung und Urgrund des christlichen Bekenntnisses überhaupt geworden.[11]
Bei diesem Text fällt auf, dass Lukas sehr paradox formuliert: Als Jesus allein war, um zu beten, waren die Jünger bei ihm. Denn wie kann Jesus allein sein, wenn er doch von seinen Jüngern umgeben ist? Diese Paradoxie ist bei Lukas freilich bewusst gewollt. Mit ihr will er zum Ausdruck bringen, dass die Leute, die die Einsamkeit des Betens Jesu nicht kennen, auch seine Identität nicht kennen können, sondern ihn für alles Mögliche halten: für Johannes den Täufer, für Elija oder sonst einen Propheten. Im Unterschied zu den Leuten können aber die Jünger erahnen, wer Jesus ist, da sie begonnen haben, an der Verborgenheit des Betens Jesu teilzuhaben. Nur weil sie in die Einsamkeit Jesu eintreten und an seinem intimen Gespräch mit dem Vater teilnehmen, dringen sie zur Identität Jesu vor und verstehen sie das Eigentliche seines Geheimnisses, wie es dann Petrus mit seinem Bekenntnis ausspricht.
Wiederum ist damit eine wichtige Wegweisung für die Entfaltung einer tragfähigen Christusökumene gegeben: Wer Jesus wirklich sehen, wer in ihm den Sohn Gottes erkennen und in ihm das Antlitz Gottes finden will, der muss ihn in seinem Beten, in seinem Eins-Sein mit dem Vater sehen. Wie bei Petrus das Bekenntnis aus der Anteilhabe an der Einsamkeit des Betens Jesu entstanden ist, so kann auch das Christusbekenntnis der Kirche heute nicht einfach ein neutraler Satz oder eine theologisch-objektive Aussage sein; es erschliesst sich vielmehr nur im Einstimmen in das Beten Jesu und muss selbst Gebet sein. Das Christusbekenntnis kann auch heute nur wachsen in der Teilhabe an der betenden Einsamkeit Jesu und im Sein mit Ihm gerade dort, wo er bei seinem Vater allein ist. Denn nur hier findet Jesus selbst seine wahre Identität als Sohn jenes Vaters, mit dem er im Gebet verbunden ist. Christuserkenntnis wird von daher nur dort zum Bekenntnis, wo sie aus dem Gebet heraus entsteht und wieder zum Gebet hinführt und sich deshalb selbst am Feuer aufhält und nicht bloss zu berichten weiss, dass es irgendwo ein solches Feuer geben soll. Umgekehrt beginnt überall dort das blosse Analysieren, wo das Feuer des Betens ausgegangen ist.
c) Verklärung im Gebet: Die Bedeutung und Wirkkraft des Betens Jesu zeigen sich sehr schön und tief im Bericht des Lukas über die Verklärung Jesu: „Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen einsamen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiss“ (Lk 9, 28-29). In diesem Bericht ist bereits aufschlussreich, dass sich auch dieses Ereignis „auf dem Berg“ zuträgt. Denn in der biblischen Tradition ist der „Berg“ immer der Raum des Gebetes, des Seins Jesu mit seinem Vater. Auf diesen Berg nimmt Jesus zudem die Drei, die den Kern der Zwölfergemeinschaft bilden, mit.
Lukas hebt dabei hervor, dass sich die Verklärung Jesu während seines Betens und der Anteilhabe der Apostel an ihm ereignet. Diese Feststellung bedeutet, dass die Verklärung ein „Gebetsereignis“ ist und in ihr eigentlich nur sichtbar wird, was ohnehin im Reden Jesu mit seinem Vater geschieht, nämlich „die innerste Durchdringung seines Seins mit Gott, die reines Licht wird. In seinem Einssein mit dem Vater ist Jesus selbst Licht vom Licht. Was er zuinnerst ist und was Petrus in seinem Bekenntnis zu sagen versucht hatte – das wird in diesem Augenblick auch sinnlich wahrnehmbar: Jesu Sein im Licht Gottes, sein eigenes Lichtsein als Sohn.“[12] Diese Sicht wird zudem dadurch bestätigt, dass die Evangelisten in der Verklärung Jesu eine Art Vorwegnahme von Ostern sehen und damit wiederum den Kern des Gebetsgeheimnisses Jesu sehr schön zum Ausdruck bringen: Der wahre Grund dafür, dass Jesus nicht im Tod bleiben konnte, sondern zu neuem Leben auferweckt wurde, liegt in der ebenso intimen wie intensiven Gebetskommunikation Jesu mit seinem Vater, die während seiner Verklärung sichtbar wird.
Wiederum ist uns damit eine elementare Wegweisung für eine glaubwürdige Christusökumene gegeben: Jesus wirklich als Sohn Gottes erkennen können wir auch heute nur, wenn wir an seiner Verklärung teilhaben und damit dessen innewerden, dass die ganze Existenz Jesu Gebet ist und dass folglich auch der Glaube an Jesus Christus nur theologische Auslegung des Betens Jesu sein kann. Denn anders als im Gebet kann man Jesus nicht verstehen, auch und gerade nicht den so genannten historischen Jesus. Der Evangelist Lukas will uns vielmehr vor Augen führen, dass gerade vom Gebet Jesu her Er vollends als der „Sohn“ offenbar ist. Denn Lukas erhebt das Beten Jesu zur „zentralen christologischen Kategorie“, von der aus er „das Sohnesgeheimnis beschreibt“[13].
d) Leiden und Sterben im Gebet: Das Beten Jesu zeigt seine Kraft nicht nur im Leben, sondern auch im Leiden und Sterben Jesu. Dies ist in besonderer Weise offenkundig am Ölberg, der für Jesus in der Stunde der beginnenden Passion vollends zum Berg seiner Einsamkeit mit dem Vater geworden ist und auf dem Jesu Zwiesprache mit seinem Vater ihre schwerste Bewährungsprobe zu bestehen hat, die im Gebet Jesu am Ölberg zum Ausdruck gebracht wird: „Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen“ (Lk 22, 42). Das Gebet ist der Ort, an dem der Sohn seinen Willen mit demjenigen das Vaters in Übereinstimmung bringt.
Für den Evangelisten Lukas ist es entscheidend wichtig, dass Jesus nicht nur betend gelebt und gelitten hat, sondern auch betend gestorben ist. Nach Lukas betet Jesus am Kreuz den grossen Passionspsalm 31: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23, 46). Im Sterben Jesu offenbart sich deshalb die letzte Tiefe seines Betens, das er in seinem Leben als Zwiesprache mit seinem Vater vollzogen hat. Lukas vermerkt zudem, dass die Gebetsworte Jesu am Kreuz von den Umstehenden nicht verstanden worden sind. Er bringt damit nochmals sensibel zum Ausdruck, dass nur der Glaube wahrnehmen kann, dass Jesus mit dem Beten des Psalms als der wahre Beter erscheint, der sich gerade als der Verlassene von seinem Vater gehalten erfährt.
4. Kirchliches Christusbekenntnis als Auslegung des Betens Jesu
Aus diesen aufgezeigten Sequenzen im Leben, Wirken und Sterben Jesu kommt an den Tag, dass das Beten Jesu das innerste Zentrum seiner Existenz und der authentische Ort seiner Identität ist, wie dies der Hebräerbrief verdichtet zum Ausdruck bringt: „Als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden“ (Hebr 5, 7). Es ist das Gebet Jesu, in dem er am deutlichsten als der Sohn des himmlischen Vaters in Erscheinung tritt, so dass in der Bezeichnung Jesu als des Sohnes die innerste Mitte der historischen Gestalt Jesus vor unsere Augen kommt. Dieses Sohnesgeheimnis Jesu ist seinerseits die innerste Mitte des kirchlichen Dogmas über Jesus Christus, insofern im Wort „homoousios“ des Konzils von Nicaea die authentische und normative Interpretation dessen gegeben ist, was der biblische Sohnestitel impliziert.
Den Nachweis, dass in der Konzilsaussage, dass Jesus als der Sohn gleichen Wesens mit seinem himmlischen Vater ist, die äusserste Verdichtung des Sohnesgeheimnisses des betenden Jesus enthalten ist, hat in exemplarischer und in überzeugender Weise Joseph Ratzinger-Benedikt XVI. mit seinem Buch über „Jesus von Nazareth“ erbracht.[14] Mit diesem Werk, das er während seines Pontifikats geschrieben hat, hat er den Versuch unternommen, „einmal den Jesus der Evangelien als den wirklichen Jesus, als den <historischen> Jesus im eigentlichen Sinn darzustellen“, und zwar in der Hoffnung , dass auch die Leser „sehen können, dass diese Gestalt viel logischer und historisch betrachtet viel verständlicher ist als die Rekonstruktionen, mit denen wir in den letzten Jahrzehnten konfrontiert worden sind“[15]. Die Herzmitte der biblischen Sicht von der Person Jesus erblickt Benedikt XVI. dabei in der ständigen Gebetskommunikation Jesu mit seinem Vater, weshalb der Papst als Konstruktionspunkt seines Werks angibt: „Es sieht Jesus von seiner Gemeinschaft mit dem Vater her, die die eigentliche Mitte seiner Persönlichkeit ist, ohne die man nichts verstehen kann und von der her er uns auch heute gegenwärtig wird.“[16]
Papst Benedikt XVI. ist dabei der Aufweis wichtig, dass das in der Heiligen Schrift bezeugte innerste Geheimnis Jesu, dass er der treue Sohn des Vaters ist, auf dem Konzil von Nicaea mit dem Wort „homoousios“ zum Ausdruck gebracht worden ist. Denn mit dieser Aussage bietet das Konzil die adäquate Auslegung des Betens Jesu: „Der Kern des in den altkirchlichen Konzilien definierten Dogmas besteht in der Aussage, dass Jesus wahrer Sohn Gottes ist, gleichen Wesens mit dem Vater und durch die Menschwerdung ebenso gleichen Wesens mit uns. Diese Definition ist im letzten nichts anderes als eine Interpretation des Lebens und Sterbens Jesu, das immerfort vom Sohnesgespräch mit dem Vater bestimmt war.“[17]
Von daher ist es zu verstehen, dass Papst Benedikt XVI. grossen Wert darauf legt, dass das Konzil von Nicaea mit dem Wort „homoousios“ keineswegs den Glauben „hellenisiert, ihn nicht mit einer fremden Philosophie befrachtet, sondern gerade das unvergleichlich Neue und Andere“ festgehalten hat, „das im Reden Jesu mit dem Vater erschienen war“[18]. Im Urteil von Papst Benedikt XVI. hat vielmehr Arius den christlichen Glauben dem aufgeklärten Verstand angepasst und ihn damit auch umgestaltet, während demgegenüber das Konzil von Nicaea die damalige Philosophie benutzt hat, um das Unterscheidende des christlichen Glaubens unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Im Bekenntnis von Nicaea hat deshalb das Konzil erneut mit Petrus zu Jesus gesprochen: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16, 16). Papst Benedikt XVI. erblickt von daher in der christologischen Konzilsdefinition die „grossartigste und kühnste Vereinfachung des komplizierten, äusserst vielschichtigen Traditionsbefundes auf eine einzige, alles andere tragende Mitte hin: Sohn Gottes, gleichen Wesens mit Gott und gleichen Wesens mit uns.“[19]
5. Arianische Strömungen in der heutigen Christenheit
Mit dieser Konzilsentscheidung hätte der Streit über die Vereinbarkeit zwischen dem Bekenntnis zum Gottsein Jesu Christi und der monotheistischen Überzeugung im vierten Jahrhundert beendet sein können. Die weitere Geschichte zeigt aber, dass der Streit, ob Jesus Christus auf die Seite Gottes oder auf die Seite der Schöpfung gehört, erneut entbrannt ist, und zwar so sehr, dass Basilius, der bedeutende Bischof von Caesarea, die nachkonziliare Situation mit einer Seeschlacht in der Nacht, in der sich alle gegen alle schlagen, verglichen und geurteilt hat, infolge der konziliaren Dispute würden in der Kirche eine „entsetzliche Unordnung und Verwirrung“ und ein „unaufhörliches Geschwätz“ herrschen[20].
Diese unerfreuliche Situation ist auch darin begründet, dass sich die christologische Lehrentscheidung des Konzils von Nicaea zunächst nur im Westen des Reiches durchzusetzen vermochte und dass nach Konstantin die Kaiser die Irrlehre des Arius wieder gefördert haben. Dies gilt vor allem von Kaiser Konstantius, dem Sohn des Kaisers Konstantin, der eine entschiedene Politik der Abkehr vom Glaubensbekenntnis des Konzils von Nicaea betrieben und sogar von einer Synode in Konstantinopel den zweideutigen Formelkompromiss hat absegnen lassen, Christus sei dem Vater „ähnlich gemäss der Schrift“.
Spätere Kaiser wie vor allem der aus dem Westen stammende Theodosius haben jedoch in der Religionspolitik wiederum auf das Konzil von Nicaea gesetzt und dieses als die einzig gültige Grundlage der Kircheneinheit bestätigt. Aufgrund dieser Entwicklungen ebenso wie aufgrund glaubwürdiger Glaubenszeugen des Nicaenischen Bekenntnisses wie Athanasius und der Arbeit der grossen kleinasiatischen Theologen Basilius, Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz konnte das Konzil von Konstantinopel im Jahre 381 das christologische Glaubensbekenntnis von Nicaea bestätigen und mit dem Bekenntnis zum Heiligen Geist ergänzen und damit das Dogma der göttlichen Trinität definieren.
Es ist hier nicht der Ort, die damalige Geschichte weiter zu skizzieren. Der Blick in die Geschichte soll unsere Aufmerksamkeit aber darauf lenken, dass auch in der heutigen kirchlichen und ökumenischen Situation die arianische Irrlehre keineswegs der Vergangenheit angehört, sondern arianische Tendenzen auch heute festzustellen sind.[21] Auch diesen Herausforderungen muss sich die ökumenische Gemeinschaft zumal im Jubiläumsjahr des 1700. Gedenkens des Ersten Ökumenischen Konzils von Nicaea stellen.
a) Eine gewisse Arianisierung des Christusglaubens ist an erster Stelle in bestimmten christlich-jüdischen Dialogen zu beobachten. Da sich die jüdische Religion durch einen strikten Monotheismus auszeichnet, besteht nicht selten die Angst, die christliche Trinitätstlehre könnte den jüdischen Monotheismus gefährden und mit ihr würde der jüdische Boden verlassen.[22] Demgegenüber ist jedoch daran zu erinnern, dass es nicht Christen aus den Völkern, sondern Judenchristen, die im Glauben Israels fest verwurzelt waren, gewesen sind, die in der frühen Kirche den Glauben an den Dreieinen Gott reflektiert und formuliert haben. Die Judenchristen haben bereits im Volk Israel erfahren, dass Gott ein naher, rettender und seinem Volk gegenüber hilfreicher Gott ist, und sie sind aufgrund solcher Erfahrungen zur Überzeugung gekommen, dass Gott mitten in seinem Volk in Jesus von Nazareth endgültig Gegenwart geworden ist, so dass sie in Jesus das endgültige Wort Gottes wahrnehmen konnten. Diese Erfahrungen wurden, wie der katholische Neutestamentler Gerhard Lohfink mit Recht feststellt, „mitten in Israel, also im Bereich des strengsten nur denkbaren Monotheismus“ gemacht[23].
Auch in denkerischer Hinsicht lässt sich zeigen, dass der trinitarische Gottesgedanke keinen Gegensatz zum Monotheismus darstellt, sondern sich im Gegenteil als Vollendung eines wahrhaften Monotheismus herausstellt. Denn erst der trinitarische Gottesgedanke vermag einen tendenziellen Dualismus zwischen Transzendenz und Immanenz Gottes und damit auch zwischen Gott und Welt zu überwinden. Denn er ermöglicht und erlaubt es zu denken, dass Gott als Schöpfer nicht nur der der Welt transzendente, sondern auch und gerade in seiner weltjenseitigen Unendlichkeit der der Welt immanente Gott ist, wie der evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg hervorhebt: „Der trinitarische Gott hebt, ohne Verwischung der Differenz von Schöpfer und Geschöpf, diesen Gegensatz auf im Gedanken der Versöhnung der Welt. Erst der trinitarisch gedachte Gott ist, ohne Beseitigung des Unterschieds von Gott und Geschöpf, sondern gerade durch Anerkennung dieses Unterschiedes auf beiden Seiten, alles in allem.“[24] Der trinitarische Gottesgedanke erweist sich dabei als konzise Formulierung der Eigenart des in dem besonderen historischen Jesusgeschehen offenbaren Gottes. Dadurch nämlich, dass die Trinitätslehre den in der Geschichte Jesu offenbaren Gott namhaft macht, formuliert sie zugleich das Verhältnis Gottes zur Geschichte insgesamt. Insofern hat das christologische und trinitarische Dogma seine jüdischen Wurzeln zwar etwas „verdeckt, aber nicht vergessen, sondern auf spezifische Weise zur Geltung gebracht“[25].
b) Arianisierende Tendenzen zeigen sich heute noch weitergehend in interreligiösen Dialogen. In den heutigen Gesellschaften, die sich durch Multikulturalität und damit auch Multireligiosität auszeichnen, stellt sich mit besonderem Ernst die Frage, wie der Christusglaube der Kirche angesichts des vielfältigen Religionsangebotes von heute verantwortet werden kann, ohne ihn zu einer bloss humanistischen Jesulogie herunterzustufen. Dies gilt zumal im Blick auf die radikalste Form des interreligiösen Dialogs, der in der religionspluralistischen Theologie vorliegt.[26] Diese geht nicht mehr davon aus, dass in Jesus Christus die Offenbarung Gottes schlechthin geschehen ist. Sie erblickt in Jesus vielmehr nur eine Offenbarungsgestalt unter vielen anderen, und zwar in der Annahme, das Geheimnis Gottes könne sich ohnehin in keiner Offenbarungsgestalt ganz zeigen. Dementsprechend wird betont, dass es nicht nur eine Vielfalt von Religionen, sondern auch eine Pluralität von Offenbarungen Gottes gibt, wobei Jesus Christus als ein religiöses Genie unter anderen im postmodernen polytheistischen Olymp betrachtet wird. Von daher besteht die Tendenz, in der Begegnung mit anderen Religionen den Christusglauben möglichst klein zu schreiben. Diese Tendenz kommt beispielsweise zum Ausdruck in der zugespitzten Frage des evangelischen Theologen Reinhold Bernhardt: „Müssen wir christologisch abrüsten, um interreligiös dialogfähig zu werden?“[27]
Mit der religionspluralistischen Bestreitung, dass Jesus Christus der eine und einzige und damit zugleich universale Mittler des Heils für alle Menschen ist, ist freilich der wohl zentralste und fundamentalste Punkt des christlichen Glaubens berührt, wie ihn das Konzil von Nicaea bekannt hat. Denn dabei steht die Identität des Christentums und der christlichen Kirche auf dem Spiel; geht es doch dem christlichen Glauben um das elementare Bekenntnis zur geschichtlichen Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth, wie es der evangelische Theologe Eberhard Jüngel präzis formuliert hat: „Im Zentrum des Christentums steht das – nun auch Judentum und Christentum voneinander trennende – Bekenntnis, dass Gott nicht nur zur Welt kommt, sondern dass Gott als Mensch, dass er in der Person Jesu von Nazareth in unüberbietbarer Weise zur Welt gekommen ist.“[28]
c) Es versteht sich leicht, dass die genannten Strömungen stets deutlicher Einfluss auf das allgemeine Glaubensbewusstsein der Christen selbst in den Kirchen gewinnen und eine Arianisierung des Christusglaubens fördern. Dies zeigt sich vor allem in dem Phänomen, dass sich nicht wenige Christen heute vor allem von den menschlichen Dimensionen der Gestalt Jesus von Nazareth berühren lassen, dass ihnen aber das Glaubensbekenntnis, dass Jesus von Nazareth der eingeborene Sohn Gottes ist, der als der Auferweckte unter uns gegenwärtig ist, und insofern der kirchliche Christusglaube weithin Mühe bereiten. Selbst in der Kirche scheint es heute oft nicht mehr zu gelingen, im Menschen Jesus von Nazareth das Antlitz Gottes wahrzunehmen und ihn als Gottessohn zu bekennen und in ihm nicht einfach einen – wenn auch besonders guten und hervorragenden – Menschen zu sehen. Damit aber wird die Gottessohnschaft Jesu Christi auf das Niveau eines heiligen Menschen heruntergestuft, wie wiederum Eberhard Jüngel mit theologischer Klarsicht geurteilt hat: „Eine nur die Beispielhaftigkeit Jesu herausstellende Christologie reduziert…die Bedeutung Jesu Christi auf die Rolle eines Heiligen, der sein Leben zwar auch zu opfern vermag, aber mit dem eigenen Lebensopfer nur zu appellieren, das Leben der Menschheit jedoch nicht effektiv zu ändern vermag. Effektiv wird das Leben der Menschheit nur dadurch verändert, dass sich das Verhältnis der Menschheit zu Gott ändert.“[29]
6. Bleibende Aktualität des Konzils von Nicaea
Dass das Verhältnis der Menschheit zu Gott verändert werden kann und wirksam verändert worden ist, eben dies bekennt der christliche Glaube vom Christusereignis, wie es das Konzil von Nicaea 325 und das Konzil von Konstantinopel 381 bezeugt haben. Und mit diesem christologischen Fundamentalbekenntnis steht oder fällt der christliche Glaube. Denn wenn Jesus, wie heute selbst nicht wenige Christen annehmen, nur ein Mensch gewesen wäre, der vor zweitausend Jahren gelebt hat, dann wäre er unwiderruflich in die Vergangenheit zurückgetreten; und nur unser eigenes Erinnern könnte ihn dann mehr oder weniger in unsere Gegenwart hereinholen. So aber könnte Jesus nicht der einzige Sohn Gottes sein, in dem Gott selbst bei uns gegenwärtig ist. Nur wenn das kirchliche Bekenntnis wahr ist, dass Gott selbst Mensch geworden und Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und so Anteil an der ewigen Gegenwart Gottes hat, die alle Zeiten umgreift, kann Jesus Christus nicht bloss gestern, sondern auch heute unser wirklicher Zeitgenosse sein.
Nur wenn Jesus nicht nur ein Mensch vor zweitausend Jahren gewesen ist, sondern auch heute lebt, können wir seine Gegenwart erfahren und können wir durch Jesus Christus erfahren, wer und wie Gott ist. Denn wer es mit dem Menschen Jesus zu tun hat, bekommt es mit dem lebendigen Gott selbst zu tun, der sein Antlitz in seinem Sohn gezeigt hat: Jesus Christus ist das „Gesicht Gottes für uns“[30]. Hier leuchtet der tiefste Grund auf, dass das christologische Dogma der Kirche das Inkarnationsgeheimnis in klassischer Weise formuliert hat, indem es von Jesus Christus ausgesagt hat, er sei „vollkommen der Gottheit und vollkommen der Menschheit nach“ und in ihm bestünden die zwei Naturen „unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert“[31].
Dabei gilt es, beide Dimensionen in der Existenz Jesu Christi ernst zu nehmen, worauf Papst Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben „Novo millennio ineunte“ hingewiesen hat: „Wenn heutzutage durch den Rationalismus, der sich in einem Grossteil der modernen Kultur breitmacht, vor allem der Glaube an die Gottheit Christi Probleme bereitet, gab es in anderen geschichtlichen und kulturellen Zusammenhängen eher die Tendenz, die historische Konkretheit der Menschheit Jesu zu schmälern oder zu zerstreuen.“[32] Ein auch nur kurzer Blick in die Geschichte des Christentums zeigt, dass es in der Tat Zeiten und Epochen gegeben hat, in denen das Bekenntnis zur Gottheit Jesu Christi und zur Menschwerdung Gottes in ihm so klar gewesen ist, dass die Menschen Mühe gehabt haben, Jesus auch als konkreten und geschichtlichen Menschen zu betrachten. In der heutigen Zeit verhält es sich jedoch weithin umgekehrt, dass vor allem der historische Mensch Jesus von Nazareth im Vordergrund steht und der Zugang zum Gottsein Jesu Christi weithin erschwert oder gar verschlossen ist. Bereits früh hat deshalb Kardinal Joseph Ratzinger hellsichtig darauf hingewiesen, dass der eigentliche Gegensatz, dem wir uns in der heutigen Situation der Kirche stellen müssen, nicht in der heute viel beschworenen Formel „Jesus ja – Kirche nein“ zum Ausdruck gebracht wird, sondern vielmehr mit der Formel umschrieben werden muss: „Jesus ja – Christus nein“ oder „Jesus ja – Sohn Gottes nein“[33].
Im Blick auf die heutige Glaubenssituation erschliesst sich erneut die bleibende Bedeutung des Konzils von Nicaea und seiner Vollendung im Konzil von Konstantinopel. Denn die Beschäftigung mit diesen Konzilien kann nicht nur von historischem Interesse sein. Ihr christologisches Bekenntnis behält vielmehr seine bleibende Aktualität auch und gerade in der heutigen Situation von Kirche und Ökumene, in der der Geist des Arius wiederum präsent geworden ist und ein starkes Wiedererwachen von arianischen Tendenzen festzustellen ist, die Einfluss auf verschiedene theologische und pastorale Problemfelder ausüben.[34] In dieser Situation erweist sich die Revitalisierung des Nicaeno-Constantinopolitanischen Christusbekenntnisses als eine ökumenische Herausforderung ersten Ranges.
Dieses Glaubensbekenntnis ist, wie der evangelische Ökumeniker Wolfhart Pannenberg hervorgehoben hat, „mit einem Anspruch auf gesamtkirchliche Geltung verbunden und von der Alten Kirche auch als für alle Christen verbindlich rezipiert“ worden[35]. Es stellt somit das stärkste ökumenische Band des christlichen Glaubens dar. Es ist von daher zu hoffen und zu wünschen, dass das 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nicaea von allen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gemeinsam begangen und sein christologisches Glaubensbekenntnis in ökumenischer Gemeinsamkeit in frischer Weise angeeignet wird.
Ebenso ist zu wünschen, dass das Jubiläum des Konzils von Nicaea neu bewusst macht, dass die Ökumene zutiefst eine Frage des Glaubens ist und dass deshalb an der Wahrheit des Glaubens vorbei die Einheit der Kirche nicht gefunden werden kann. Denn das ökumenische Bemühen ist der Wiedergewinnung der Einheit der Kirche als jener Gemeinschaft gewidmet und verpflichtet, die in Treue zum Evangelium Jesu Christi und zum Apostolischen Glauben der Kirche lebt. Die wieder zu gewinnende Einheit der Kirche berührt zutiefst die Wahrheit des Glaubens, wie Papst Benedikt XVI. mit deutlichen Worten in Erinnerung gerufen hat: „Die Einheit der Kirche kann, in einem Wort, nie etwas anderes sein als Einheit im Apostolischen Glauben, in dem Glauben, der jedem neuen Glied am Leib Christi im Taufritus anvertraut wird. Dieser Glaube vereint uns mit dem Herrn, gibt uns Anteil am Heiligen Geist und macht uns auch zu Teilhabern am Leben der Heiligen Dreifaltigkeit, dem Modell der koininia der Kirche auf Erden.“[36]
Diese gemeinsame Wahrheit des Glaubens in ökumenischer Gemeinschaft zu bezeugen und den Glauben der Alten Kirche treu zu bewahren, ist die Herausforderung an die Ökumene heute. Ökumene ist deshalb entweder Bekenntnisökumene oder sie ist nicht christliche Ökumene. In diesem Sinn bilden das Konzil von Nicaea und sein rundes Jubiläum das Fundament wahrhafter geistlicher Ökumene.
[1] Vgl. Erstes Konzil von Nizäa 325, in: J. Wohlmuth (Hrsg.), Dekrete der Ökumenischen Konzilien. Band I: Konzilien des Ersten Jahrtausends (Paderborn 2002) 1-19, zit. 5 und 16.
[2] J. Kardinal Ratzinger, Das Credo von Nikaia und Konstantinopel. Geschichte, Struktur und Gehalt, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine der Fundamentaltheologie (München 1982) 116-127, zit. 123.
[3] Confessio Augustana, Schluss des Ersten Teils.
[4] Vgl. K. Kardinal Koch, Auf dem Weg zu einer ökumenischen Feier des 1700. Jahrestags des Konzils von Nicaea (325 – 2023), in: P. Knauer, A. Riedl, D. W. Winkler (Hrsg.), Patrologie und Ökumene. Theresia Hainthaler zum 75. Geburtstag (Freiburg i. Br. 2022) 320-341.
[5] Benedikt XVI., Predigt im Vespergottesdienst zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen am 25. Januar 2008.
[6] Unitatis redintegratio, Nr. 8.
[7] Vgl. K. Kardinal Koch, Christliche Ökumene im Licht des Betens Jesu. „Jesus von Nazareth“ und die ökumenische Sendung, in: J.-H. Tück (Hrsg.), Passion aus Liebe. Das neue Jesus-Buch des Papstes in der Diskussion (Mainz 2011) 19-36.
[8] W. Kardinal Kasper, Ökumene und Spiritualität, in: Ders., Wege der Einheit. Perspektiven für die Ökumene (Freiburg i. Br. 2005) 203-226, zit. 204.
[9] Benedikt XVI., Katechese bei der Generalaudienz am 30. November 2011.
[10] Vgl. J. Kardinal Ratzinger, Christologische Orientierungspunkte, in: Ders., Schauen auf den Durchbohrten. Versuche zu einer spirituellen Christologie (Einsiedeln 1984) 13-40.
[11] Vgl. zum Folgenden bes. J. Ratzinger – Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung (Freiburg i. Br. 2007), bes. 333-365: 9. Kapitel: Zwei wichtige Markierungen auf dem Weg Jesu: Petrusbekenntnis und Verklärung.
[12] Ebda., 357-358.
[13] J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den Dreieinigen Gott (München 1976) 67.
[14] Vgl. K. Koch, Der treue Sohn des Vaters. Einführende Erwägungen zum Jesus-Buch von Papst Benedikt XVI., in: Ders., Das Geheimnis des Senfkorns. Grundzüge des theologischen Denkens von Papst Benedikt XVI. = Ratzinger-Studien. Band 3 (Regensburg 2010) 146-158.
[15] J. Ratzinger – Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung (Freiburg i. Br. 2007) 20-21.
[16] Ebda., 12.
[17] J. Kardinal Ratzinger, Christologische Orientierungspunkte, in: Ders., Schauen auf den Durchbohrten. Versuche zu einer spirituellen Christologie (Einsiedeln 1984) 13-40, zit. 29.
[18] J. Ratzinger – Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung (Freiburg i. Br. 2007) 407.
[19] J. Ratzinger, Was bedeutet Jesus Christus für mich? in: Ders., Dogma und Verkündigung (München 1973) 137-149, zit. 138.
[20] Basilius, De Spiritu Sancto XXX, 77.
[21] Vgl. K.-H. Menke, Das Homoousios to patrí scheidet die Geister. Zur kriteriellen Funktion des Symbolum Nicaenum, in: Communio. Internationale Katholische Zeitschrift 53 (2024) 396-412, bes. 403-409: Arius redivivus, oder: Das Nicaeno-Constantinopolitanum unter dem Beschuss von Nominalismus, Moderne und Postmoderne.
[22] Vgl. W. Homolka / M. Striet, Christologie auf dem Prüfstand. Jesus der Jude – Christus der Erlöser (Freiburg i. Br. 2019).
23] G. Lohfink, Warum ich an Gott glaube (Freiburg i. Br. 2024) 65.
[24] W. Pannenberg, Probleme einer trinitarischen Gotteslehre, in: W. Bauer u. a. (Hrsg,), Weisheit Gottes – Weisheit der Welt. Festschrift für Joseph Kardinal Ratzinger zum 60. Geburtstag. Band 1 (St. Ottilien 1987) 329-341, zit. 341.
[25] J.-H. Tück, „Gleichwesentlich mit dem Vater“. Hat das Konzil von Nizäa die jüdischen Wurzeln des Christentums abgeschnitten? in: Communio. Internationale Katholische Zeitschrift 53 (2024) 382-395, zit. 393.
[26] Vgl. R. Schwager, Christus allein? Der Streit um die pluralistische Religionstheologie (Freiburg i. Nr. 1996).
[27] R. Bernhardt, Desabsolutierung der Christologie? in: M. v. Brück / J. Werbick (Hrsg.), Der einzige Weg zum Heil? Die Herausforderung des christlichen Absolutheitsanspruchs durch die pluralistische Religionstheologie (Freiburg i. Br. 1993) 184-200.
[28] E. Jüngel, Zum Wesen des Christentums, in: Ders., Indikativ der Gnade – Imperativ der Freiheit = Theologische Erörterungen IV (Tübingen 2000) 1-23, zit. 18.
[29] E. Jümgel, Das Opfer Jesu Christi als sacramentum et exemplum. Was bedeutet das Opfer Jesu Christi für den Beitrag der Kirchen zur Lebensbewältigung und Lebensgestaltung? in: Ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens = Theologische Erörterungen III (München 1990) 251-282, zit. 267.
[30] J. Cardinal Ratzinger, „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh 14, 9). Das Antlitz Christi in der Heiligen Schrift, in: Ders., Unterwegs zu Jesus Christus (Augsburg 2003) 11-30, zit 26.
[31] J. Neuner / H. Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung (Regensburg 1971) Nr. 178.
[32] Johannes Paul II., Novo millennio ineunte, Nr. 22.
[33] J. Kardinal Ratzinger, Christus und Kirche. Aktuelle Probleme der Theologie – Konsequenzen für die Katechese, in: Ders., Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart (Freiburg i. Br. 1995) 57-55, zit. 47.
[34] Vgl. zum Beispiel F. J. Baur, Arianismus und Priestermangel, in: Ch. Schaller, M. Schulz, R. Voderholzer (Hrsg.), Mittler und Befreier. Die christologische Dimension der Theologie. Für Gerhard Ludwig Müller (Freiburg i. Br. 2008) 60-77.
[35] W. Pannenberg, Die Bedeutung des Bekenntnisses von Nicaea-Konstantinopel für den ökumenischen Dialog heute, in: Ders., Beiträge zur Systematischen Theologie. Band 3: Kirche und Ökumene (Göttingen 2000) 194-204, zit. 197.
[36] Benedikt XVI., Grussworte am Schluss des Abendgebetes in der Westminster Abbey in London am 17. September 2010.