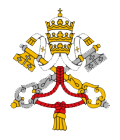Grußwort an die Ratsversammlung
DES LUTHERISCHEN WELTBUNDES (LWB)
12.-18. Juni 2024, Genf
P. Dr. Augustinus Sander OSB
(Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen)
Sehr geehrter Herr Präsident Bischof Stubkjær,
sehr geehrte Frau Generalsekretärin Pfarrerin Burghardt,
liebe Schwestern und Brüder in der „Gemeinschaft der Hoffnung“ (vgl. Röm 15,13),
zu Ihrer diesjährigen Ratsversammlung – im neuen interimistischen Ambiente – grüße ich Sie sehr herzlich. Zugleich darf ich Ihnen die Segenswünsche von Herrn Kardinal Koch, dem Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, übermitteln und ebenso die guten Wünsche unseres neuen Sekretärs im Dikasterium, Herrn Erzbischof Pace.
Als Ratsversammlung tagen Sie diesmal in neuer personeller Zusammensetzung. Eine eigene Delegation wird in der kommenden Woche in Rom zu Gast sein und vom Heiligen Vater Papst Franziskus in Audienz empfangen werden. Doch bis dahin haben Sie viel zu tun, wie ein Blick auf Ihre gut gefüllte Agenda bestätigt.
Mögen Sie bei allem, was Sie tun und auch lassen müssen, immer mehr zu einer „Gemeinschaft der Hoffnung“ werden, vom „Gott der Hoffnung“ reich beschenkt, wie es der Römerbrief bekennt (15,13).
Der nüchterne Blick auf die Wirklichkeit, wie sie ist, und der hoffnungsvolle Blick auf die Wirklichkeit, wie sie sein wird, schließen sich nicht aus. Lutherische Christen sind damit vertraut, in einem „Simul“, in einem „Zugleich“, Gegensätzliches zusammenzuschauen. Das „Simul“ von „Hoffnung wider alle Hoffnung“, „spes contra spem“, hat freilich nichts Statisches; vielmehr liegt darin eine innere Dynamik, die mehr und mehr die Hoffnung hervortreten und hervorleuchten läßt.
Wir glauben an den unter uns gegenwärtigen Christus, der ja die Hoffnung in Person ist. Durch die Taufe sind wir „wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ (1 Petrus 1,3) und ermächtigt, Träger und Boten der Hoffnung zu werden.
Wer hätte, wenn wir auf unsere Trennungsgeschichte schauen, noch vor 100 Jahren jemals zu hoffen gewagt, daß lutherische und katholische Christen gemeinsame Wege gehen könnten? Wer hätte noch vor 60 Jahren jemals zu hoffen gewagt, daß lutherische und katholische Christen einen differenzierten Konsens in der Rechtfertigungslehre wiedererkennen und gemeinsam formulieren könnten? Wer hätte noch vor 10 Jahren jemals zu hoffen gewagt, daß der Papst und der Präsident des Lutherischen Weltbundes den Gedenktag der Wittenberger Reformation in einem gemeinsamen Gebetsgottesdienst in einer lutherischen Kirche begehen könnten?
Das 25jährige Jubiläum der Unterzeichnung der „Gemeinsamen Offiziellen Feststellung“ zur Rechtfertigungslehre, das wir in diesem Jahr begehen, könnte in unseren Gemeinden weltweit zu einem „Fest der Hoffnung“ werden – nicht nur für Lutheraner und Katholiken, sondern auch für Methodisten, Anglikaner und Reformierte, die inzwischen auf ihre Weise der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ zugestimmt haben.
Es gab – Gott sei Dank - zu allen Zeiten ökumenische Hoffnungsträger, die schon mehr sahen als nur die Spaltung. Es gab ökumenische Vorboten der Hoffnung, deren nüchterner Blick sich im Glauben mit einer größeren und weiteren Sichtweise verbinden konnte, und es gibt sie auch heute.
Vor den Toren der Lutherstadt Eisleben liegt das katholische Kloster Helfta, jahrhundertelang eine Ruine, nach der deutsch-deutschen Wende wieder neu aufgebaut. Der Altar der Klosterkirche ist etwas Besonderes; denn sein Sockel ist aus Steinen zusammengefügt, die aus benachbarten evangelischen und katholischen Kirchengebäuden stammen.
In Helfta ist gleichsam ein Altar der Hoffnung entstanden: ein Ort, der die Hoffnung wachhält angesichts der noch schmerzlich trennenden Unterschiede im Glauben und der noch nicht möglichen Gemeinschaft in der Eucharistie; ein Ort des hoffnungsvollen Gebetes für die volle sichtbare Einheit der Kirche; ein Ort, an dem die Hoffnung auf das, was – hoffentlich! – zukünftig einmal möglich sein wird, wachsen und reifen kann.
Liebe Schwestern und Brüder in der „Gemeinschaft der Hoffnung“, lassen wir darum nicht ab, nüchtern und hoffnungsvoll unseren bewährten theologischen Dialog fortzusetzen. Als ökumenische Hoffnungsträger verschließen wir nicht die Augen vor dem, was noch trennt. Doch lassen Sie uns als ökumenische Vorboten darauf vertrauen, daß in der „Gemeinschaft der Hoffnung“ etwas wächst und heranreift, das all unsere Hoffnung noch übertreffen wird.
„Der Gott der Hoffnung“ sei mit uns allen.