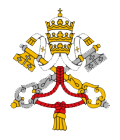Festvortrag beim Symposium
„1054 - Gab es wirklich ein ‚Schisma‘ zwischen Ost- und Westkirche?“
(Universität Wien am 16. Januar 2025)
NACH DEM EKLAT VON 1054 –
AUF DEM WEG ZUR WIEDERGEWINNUNG DER EINHEIT
DER KIRCHE IN OST UND WEST
Nach einer langen Zeit der Trennung in der Kirche zwischen Ost und West haben auf dem ebenso langen Weg auf das Wiederfinden der verlorenen Einheit hin die Ereignisse vom 7. Dezember 1965 einen entscheidenden Meilenstein gebildet.[1] An diesem Datum und damit am Tag vor der Schlussitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils haben Papst Paul VI. und der Ökumenische Patriarch Athenagoras von Konstantinopel von ihren beauftragten Repräsentanten, Monsignore Johannes Willebrand und dem Sekretär des Heiligen Synod des Patriarchats von Konstantinopel, zur gleichen Zeit in der Basilika Sankt Peter in Rom und in der Kathedrale St. Georg im Phanar in Konstantinopel eine «Gemeinsame Erklärung» vortragen lassen, in der es heisst: «Die Exkommunikations-Sentenzen», die auf die «traurigen Ereignisse dieser Epoche» gefolgt sind und «deren Erinnerung einer Annäherung in der Liebe bis heute hindernd im Wege stehen», werden bedauert, «aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche» getilgt und «dem Vergessen anheimgegeben»[2].
1. Der Eklat von 1054 und seine Folgen
In der erwähnten «Gemeinsamen Erklärung» von Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras ist von «Exkommunikations-Sentenzen» die Rede, die dem Vergessen anheimgegeben werden sollen. Doch was ist damit gemeint, und welches sind die «traurigen Ereignisse dieser Epoche», von denen in der «Gemeinsamen Erklärung» gesprochen wird?[3] Diesbezüglich ist zunächst festzuhalten, dass die Delegation aus Rom, die im Jahre 1054 nach Konstantinopel gekommen ist, nicht geschickt worden ist, um einen Bann zu überbringen. Sie hatte im Gegenteil den Auftrag der Friedensvermittlung im Blick auf die aufgrund des Einmarsches der Normannen in Süditalien entstandenen Probleme zwischen der lateinischen und der griechischen Kirche, da die dortigen Bistümer mit griechischsprachigen Gläubigen zum Patriarchat von Konstantinopel gehörten, von den Normannen aber lateinische Kirchenführer über das Volk mit griechischen Kirchenbräuchen eingesetzt worden waren.
Wiewohl die Bedrohung durch die Normannen sowohl in Konstantinopel als auch in Rom verspürt worden ist, führten die Verhandlungen nicht zum Kirchenfrieden, sondern haben mit einem Eklat geendet. Dies ist vor allem der Tatsache zuzurechnen, dass auf beiden Verhandlungsseiten Persönlichkeiten beteiligt gewesen sind, die durch ihre Unnachgiebigkeit bekannt gewesen sind. In Konstantinopel war Patriarch Michael Kerullarios im Amt, der politisch sehr ambitioniert gewesen ist und sich früher sogar Ambitionen auf den Kaiserthron gemacht und vor allem befürchtet hat, dass ein Zusammengehen von Papst und Kaiser auf Kosten der Unabhängigkeit des Patriarchats gehen würde. Auf der anderen Seite wurde die Delegation aus Rom von Kardinal Humbert von Silva Candida angeführt, der als Berater des Papstes ein Mensch mit einem aufbrausenden Temperament gewesen ist.
Die römischen Legaten waren zunächst bestrebt, den Patriarchen zu bewegen, seine früheren verbalen Ausfälle gegen die Bräuche der Lateiner zurückzunehmen. Als zusätzlich der in Byzanz sehr verehrte Studitenmönch Niketas Stethatos Schriften gegen den Brauch von Azymen in der lateinischen Kirche verbreitet hat, war Kardinal Humbert gewillt, den Einfluss des Patriarchen selbst zu brechen. So ist es zum Eklat am 16. Juli 1054 gekommen, als der Kardinal mit seinen Begleitern auf dem Altar der Hagia Sophia die Bannbulle gegen den, wie es in der Bulle heisst, «Pseudo-Patriarchen Michael» und gegen Erzbischof Leon von Ochrid und deren Helfer niedergelegt hat. Nur wenige Tage später, nämlich am 20. Juli 1054 hat Patriarch Michael den Gegenbann gegen die Urheber der Exkommunikationsbulle ausgesprochen. Zusätzlich hat er ein Zurückweisungsprotokoll veröffentlicht, mit dem er bestrebt war, den Papst und die lateinische Kirche aus dem Skandal herauszuhalten.
Diese verschiedenen Details müssen wenigstens kurz erwähnt werden, damit deutlich wird, dass die Exkommunikationsbullen nicht gegen Kirchen, sondern allein gegen einzelne Persönlichkeiten gerichtet gewesen sind: Die römischen Legaten haben den Patriarchen und einige seiner Mitarbeiter exkommuniziert, und einige Tage später hat der Patriarch die Legaten exkommuniziert. In den diesbezüglichen Texten werden denn auch die von den Exkommunikationen unmittelbar betroffenen Personen eigens erwähnt, während die Kirchen als ganze von der beabsichtigten Wirkung der Exkommunikationen ausdrücklich ausgenommen werden. An diesen wichtigen Sachverhalt wird auch in der «Gemeinsamen Erklärung» von Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras erinnert, indem dort die von der Exkommunikation betroffenen Personen eigens mit Namen genannt werden und hinzugefügt wird, die Zensuren hätten sich «auf die Personen und nicht auf die Kirchen gerichtet» und sie hätten nicht beabsichtigt, die kirchliche Gemeinschaft zwischen den Sitzen von Rom und Konstantinopel» zu brechen.
Aus diesen historischen Beobachtungen kann nur der Schluss gezogen werden, dass es im Jahre 1054 keine Exkommunikation der lateinischen gegen die griechische Kirche und umgekehrt gegeben hat. Kardinal Humbert hat keine formal gültige Bannung oder gar Exkommunikation der byzantinischen Kirche ausgesprochen, zumal seine Exkommunikationssentenz ohnehin keine kanonische Gültigkeit haben konnte, da Papst Leo IX. drei Monate vorher gestorben war. Und auch in den Augen von Patriarch Michael hat der Eklat von 1054 kein Schisma bedeutet. Den Exkommunikationsbullen darf deshalb auch heute nicht eine Bedeutung zugesprochen worden, die sie auch in der Geschichte nicht gehabt haben.
Natürlich hat der Eklat von 1054 damals eine schmerzliche Belastung in den kirchlichen Beziehungen bedeutet. Er ist aber damals nicht als Ursache für das spätere Schisma betrachtet worden. Dies ist erst später geschehen, als die Ereignisse von 1054 als Datum des Beginns des Schismas zwischen Lateinern und Griechen angesetzt worden sind. Dabei ist offensichtlich nicht mehr bewusst gewesen, dass es sich beim Jahr 1054 weniger um ein historisches als vielmehr um ein symbolisches Datum handelt und dass in der Kirche zwischen Ost und West kein Schisma im eigentlichen Sinne stattgefunden hat und auch keine endgültige gegenseitige formelle Verurteilung weder im Jahre 1054 noch zu einem späteren Datum erfolgt ist. Diesen bedeutsamen Sachverhalt hat der Orthodoxe Grazer Theologe Grigorius Larentzakis auf die sensible Kurzformel gebracht: «Kein Schisma, trotzdem getrennt»[4].
2. Gegenseitige Entfremdung in der Geschichte
Von daher legt es sich nahe, nicht von einem Schisma zu sprechen, sondern von einer zunehmenden Entfremdung in der Kirche zwischen Ost und West. Vor allem Yves Congar hat sehr früh gezeigt, dass die Trennung zwischen Katholiken und Orthodoxen ihre Ursache nicht in den Ereignissen von 1054 gehabt hat, sondern in jenem langen geschichtlichen Prozess, den er als „Entfremdung“ charakterisiert hat. Dem gemäss hat sich die Trennung nicht wie ein abrupter Bruch im Augenblick der Anathematismen vollzogen, sondern durch eine fortschreitende Entwicklung, die bereits vor dem 11. Jahrhundert begonnen hat. Die Trennung war deshalb auch nicht das Ergebnis einer Initiative von nur einer Seite, sondern einer gegenseitigen Unkenntnis voneinander[5].
Die spätere Trennung hat ihren Grund vor allem darin, dass in der westlichen und östlichen Christenheit das Evangelium Jesu Christi eigentlich von Anfang an in einer unterschiedlichen Art und Weise aufgenommen und in verschiedenen Ausformungen gelebt und weitergegeben worden ist, weshalb man beispielsweise auch zwischen griechischen und lateinischen Kirchenvätern unterscheidet. Mit solchen Differenzen haben die kirchlichen Gemeinschaften im Ersten Jahrtausend in Ost und West in der einen Kirche gelebt. Sie haben sich aber immer mehr voneinander entfremdet und konnten sich immer weniger verstehen[6]. Dies hat zu einem grossen Teil die spätere Trennung in der Kirche zwischen Ost und West zumindest mitverursacht, wie Kardinal Walter Kasper mit Recht urteilt: „Die Christenheit hat sich nicht primär auseinander diskutiert und über unterschiedlichen Leerformeln zerstritten, sondern auseinander gelebt.“[7]
a) Einheit im Glauben und Unterschied im theologischen Ausdruck
Bei diesen Prozessen einer gegenseitigen Entfremdung zwischen Ost und West haben vor allem unterschiedliche Spiritualitäten eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Sie haben nicht selten zu Unverständnis und Missverständnissen geführt und sind teilweise an Fragen festgemacht worden, die wir heute entweder als Äusserlichkeiten – wie beispielsweise die Barttracht der Kleriker oder andere unterschiedliche disziplinäre Anweisungen – einschätzen oder die wir als Ausfaltungen innerhalb einer gegebenen Gemeinsamkeit verstehen, wie beispielsweise die Verwendung von gesäuertem oder ungesäuertem Brot in der Feier der Eucharistie oder andere Unterschiede in den Riten oder die verschiedenen liturgischen Kalender vor allem was die Datierung des Osterfestes betrifft.
Es sei nur daran erinnert, dass die Frage der Verwendung der ungesäuerten Brote bereits im Vorfeld des Eklats von 1054 eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, als Patriarch Michael den Erzbischof Leon von Ochrid im Jahre 1053 eine Schrift verfassen liess, die Bischof Johannes von Trani in Süditalien verbreiten sollte und in der die Ungesäuerten Brote der Lateiner, die sogenannten Azymen und ihr Gebrauch in der Feier der Eucharistie geschmäht werden. Im Blick auf diesen Streit um die Azymen hat der katholische Ostkirchenhistoriker Hans-Joachim Schulz wohl mit Recht von einem «grotesken Missverhältnis zwischen glaubensmässiger Relevanz und ekklesialen Folgen» gesprochen[8].
Aufschlussreich ist ferner die Feststellung, dass in den Auseinandersetzungen im Vorfeld des Eklats von 1054 jene Frage kaum von eminenter Bedeutung gewesen ist, die später zur grossen Kontroverse geworden und sogar als der theologisch tiefste Grund der späteren Spaltung zwischen West und Ost betrachtet geworden ist, nämlich die Frage des so genannten «Filioque», des Bekenntnisses der Lateiner, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht oder, wie die Griechen sagen, nur vom Vater.[9] Dieser theologische Unterschied hat ursprünglich keinen grösseren Konflikt dargestellt. Denn in der lateinischen Kirche war es schon lange Praxis gewesen, vom Ausgang des Heiligen Geistes «vom Vater und vom Sohn» zu sprechen, bevor das Glaubensbekenntnis des Konzils von Konstantinopel, in dem vom Ausgang des Heiligen Geistes allein «vom Vater» gesprochen wird, im Westen bekannt geworden ist. Gegen die Praxis der Lateiner haben die griechischen Kirchen damals keinen Einwand erhoben, und auch die Lateiner haben nicht gegen den Wortlaut des neuen Glaubensbekenntnisses protestiert. Man ist vielmehr der gemeinsamen Überzeugung gewesen, dass beide theologischen Verständnisse und Redeweisen dieselbe Glaubenswahrheit in der jeweils anderen theologischen Denkweise und Sprache adäquat zum Ausdruck bringen. Später jedoch, als man sich offensichtlich nicht mehr verstehen konnte, sind die unterschiedlichen theologischen Sichten zum Anlass von gegenseitigen Polemiken geworden und als entscheidender theologischer Grund für die spätere Spaltung namhaft gemacht worden.
Das Bewusstsein, dass Griechen und Lateiner denselben Glauben bekennen, auch wenn sie ihn verschieden ausdrücken, ist auch in der späteren Geschichte präsent geblieben. Als beispielsweise im 11. und 12. Jahrhundert Papst und Kaiser die Vereinigung angestrebt und sie durch eine theologische Übereinkunft über die Frage des Filioque zu erreichen gesucht haben, weil sie sie für den Hauptgrund der Spaltung gehalten haben, konnten auf dem Zweiten Konzil von Lyon im Jahre 1274 zunächst die Lateiner ihre Lehre vom Ausgang des Heiligen Geistes vom Vater und vom Sohn in einer Weise erklären, die die Einwände der Griechen zu beantworten vermochten, worauf die Abgesandten des Kaisers dieser Erklärung im Namen der Kirche der Griechen zustimmten. Darauf haben Lateiner und Griechen das Glaubensbekenntnis gemeinsam gesungen. Auch auf dem Konzil von Ferrara –Florenz 1438-1439, das einberufen wurde, um das Schisma zu beenden, wurde der Frage des Filioque viel Zeit des Nachdenkens gewidmet[10]. In der Gewissheit, dass der Heilige Geist, der die Kirche in die Wahrheit einführt, die Lehren der Griechen und der Lateiner zugelassen habe, sind die Konzilsteilnehmer zu der Überzeugung gekommen, dass beide Formulierungen im Bekenntnis der Wahrheit des christlichen Glaubens entsprechen und dass folglich die Kirche beide Weisen zulassen könne.
b) Faktoren der weitergehenden Entfremdung
Als freilich die Abgesandten des Kaisers vom Konzil von Lyon zurückkamen, erfuhren sie keine Bereitschaft, die erarbeitete theologische Lösung anzunehmen, so dass das Schisma fortdauerte. Und obwohl auf dem Konzil von Ferrara-Florenz mit einer Ausnahme alle Konzilsväter den theologischen Einigungstext unterschrieben haben, musste er weithin ohne Auswirkungen bleiben, da sowohl die Lateiner als auch die Griechen keine Bereitschaft zeigten, aus der theologischen Übereinkunft praktische Konsequenzen für das kirchliche Leben zu ziehen. Offensichtlich war die wechselseitige Entfremdung bereits so weit vorangeschritten, dass das Bewusstsein, auch bei unterschiedlichen Denkweisen denselben Glauben zu bekennen, weithin nicht mehr präsent gewesen ist. Den Faktoren, die zu dieser weiteren gegenseitigen Entfremdung beigetragen haben, muss deshalb in einem nächsten Schritt kurz nachgegangen werden.
Im Laufe der Geschichte wurden die bei den Griechen und Lateinern unterschiedlichen Bräuche gegenseitig respektiert. Später jedoch wurden sie umgekehrt zur gegenseitigen Anklage benutzt. Dies ist vor allem manifest geworden in der kritischen Situation im 9. Jahrhundert, als nach der Absetzung von Patriarch Ignatios I. Photios Patriarch von Konstantinopel geworden war.[11] Da er aus dem Laienstand direkt in den Patriarchenrang erhoben worden ist, haben die so genannten «Zeloten» dagegen protestiert. Ihre Partei hat auch Papst Nikolaus I. ergriffen; er hat nicht nur die Absetzung des Photios und die Wiedereinsetzung des Ignatios verlangt, sondern auch den Byzantinern vorgeworfen, dass sie mit ihrem Handeln nicht den römischen Normen entsprochen haben. In einem Brief hat er zehn Punkte erwähnt, hinsichtlich derer Photios sich den Lateinern widersetzt habe. Als Reaktion darauf hat Patriarch Photios verschiedene polemische Briefe verfasst, in denen er die Lateiner wegen ihrer besonderen Formulierungen bei der Darstellung des gemeinsamen Glaubens und wegen ihrer gottesdienstlichen Bräuche angeklagt hat. Unter den neun Punkten, die inkriminiert wurden, fanden sich neben der Lehre vom Ausgang des Heiligen Geistes vom Vater und vom Sohn auch das Fasten der Lateiner am Samstag, die Zölibatsverpflichtung der Priester, der Brauch, dass die Firmung nicht gleich nach der Taufe gespendet wird, und das Bartscheren der lateinischen Kleriker. An diese kritische Situation sei im Sinne eines Beispiels dafür erinnert, wie herkömmliche Unterschiede zwischen Griechen und Lateinern, die bisher gegenseitig respektiert worden sind, später als Vorwand für die Behauptung genommen worden sind, dass die Spaltung aus gewichtigen theologischen Gründen notwendig geworden sei.
Noch mehr als diese Entwicklungen und noch viel mehr als selbst der Eklat von 1054 haben die Kreuzzüge zu einer wechselseitigen Entfremdung zwischen Griechen und Lateinern beigetragen. Sie sind zwar ursprünglich von Byzanz angeregt worden, wo angesichts der Bedrängnis durch die Seldschuken der Kaiser vom Westen militärische Hilfe beim Kampf um den freien Zugang zu den heiligen Stätten in Palästina erbeten hat. Byzanz musste jedoch die Erfahrung machen, dass die Lateiner, statt dem Kaiser zu Hilfe zu kommen, eigene Kreuzfahrerstaaten errichtet und sich als Invasoren erwiesen haben. Dies hat vor allem bedeutet, dass die Kreuzfahrer in den genannten Gebieten, sobald ein Bischofsitz der Griechen vakant geworden ist, sie ihn mit Priestern besetzt haben, die mit ihnen aus dem Westen gekommen waren. Diese neuen lateinischen Bischöfe waren dann nicht nur für die Kreuzfahrer, sondern auch für die Griechen zuständig. So wurden zum Beispiel in Antiochien und Jerusalem Lateiner als Patriarchen für die Lateiner und die Griechen eingesetzt. Ein solches Vorgehen hat den anfänglich wechselseitigen Respekt zwischen Lateinern und Griechen gewiss nicht gefördert, sondern ihm sehr geschadet.
Hinzu kamen die schrecklichen Gräueltaten der Kreuzfahrer, als sie im Jahre 1204 Konstantinopel erobert haben. Dieser Kreuzzug ist zwar zunächst mit einem positiven Ziel ausgerufen worden. Aus politischen Gründen ist dann aber von den venezianischen Seeleuten Konstantinopel geplündert worden, obwohl Papst Innozenz III. streng verboten hat, Krieg gegen Christen zu führen – eine Mahnung, die im Blick auf den Krieg in der Ukraine neue Aktualität gewonnen hat. Es darf auch nicht verschwiegen werden, dass der Eroberung politische Intrigen der Griechen und in Konstantinopel ein Pogrom an den Lateinern vorausgegangen waren. Die Tatsache aber, dass die Stadt Konstantinopel von christlichen Brüdern eingenommen, viele Menschen umgebracht worden und auch Kirchen und Kloster nicht verschont geblieben sind, stellt aus verständlichen Gründen eine blutende Wunde dar. Sie ist noch heute im Gedächtnis vieler orthodoxen Christen so sehr präsent, als lägen diese tragischen Ereignisse erst in der jüngeren Vergangenheit. Auch das Verhalten der Lateiner gegenüber den Griechen, nämlich ihre Unterwerfung, hat auch nach der Eroberung von Konstantinopel in der Sicht der Griechen die Kirchen weiter und noch tiefer gespalten.
c) Zunehmende Schismen zwischen Lateinern und Griechen
Zu einer weiteren gravierenden Entfremdung haben problematische Entwicklungen sowohl bei den Lateinern als auch bei den Griechen beigetragen, die teilweise auch zu Schismen geführt haben. Auf lateinischer Seite hat zweifellos die Krönung von Kaiser Karl dem Grossen durch Papst Leo III. für das ganze Reich zu einer gefährlichen Trennung des Reiches geführt. Während in der Spätantike die Teilung des Reiches in ein Ost- und ein Westreich auf einer gegenseitigen Vereinbarung beruht hat, haben nun beide Seiten den Anspruch erhoben, über den einzigen rechtmässigen Römerkaiser zu verfügen. Da es keine Instanz mehr gegeben hat, die auf beiden Seiten anerkannt worden wäre, damit niemand mehr die Einladung zu einem Ökumenischen Konzil an die Bischöfe von beiden Seiten aussprechen konnte und in der Folge nach der Kaiserkrönung Karls kein von beiden Seiten anerkanntes Ökumenisches Konzil mehr stattgefunden hat, hat sich die Krönung als für die Einheit der Kirche sehr schädlich herausgestellt.
Auf der Seite der Griechen ist an das Akakianische Schisma zu erinnern, als Kaiser Zenon von Bischof Akakios von Konstantinopel das so genannte „Henotikon“ verfassen liess, es veröffentlichte und allen Kirchen des Reiches vorschrieb, es als ihr Glaubensbekenntnis anzunehmen. Die Kirchen aber, die dem Ökumenischen Konzil von Chalkedon treu bleiben wollten, haben daraufhin von der Kirche von Konstantinopel verlangt, dieses Glaubensbekenntnis wieder abzuschaffen. Da sich die Kirche von Konstantinopel jedoch verweigert hat, dies zu vollziehen, haben sie ihr die Sakramentengemeinschaft aufgekündigt. Denn sie wollten mit der Kirche von Konstantinopel nicht weiter in Sakramentengemeinschaft leben, wenn diese es zulässt, dass der Kaiser befugt ist, in der Kirche Lehrautorität auszuüben.
Diese beiden Beispiele seien genannt, um zu verdeutlichen, dass es in der Geschichte immer wieder zu Schismen zwischen Griechen und Lateinern gekommen ist, und zwar bereits auch vor den Ereignissen im Jahre 1054. Yves Congar weiss zu berichten, dass es während den über 460 Jahren seit dem Beginn der Alleinherrschaft Konstantins bis zum Siebten Ökumenischen Konzil fünf Schismen während insgesamt 203 Jahren gegeben hat, ohne dass freilich die eine Seite der anderen das Kirche-Sein abgesprochen hätte.[12] Auch wenn die Kirchen einander sehr schwere Misstände vorgehalten und deshalb die Sakramentengemeinschaft abgebrochen haben, haben sie sich dennoch weiterhin als Schwesterkirchen, die eigentlich zusammengehören, anerkannt.
Diesbezüglich hat sich die Situation am Beginn des 18. Jahrhunderts massgeblich geändert. In der Fernwirkung des Konzils von Trient ist unter den Lateinern die Überzeugung immer mehr verbreitet gewesen, dass die Kirche Jesu Christi nur dort gegeben sein könne, wo der Nachfolger Petri die Gemeinschaft der Gläubigen leite, und dass deshalb die Sakramente, die ausserhalb der pastoralen Zuständigkeit des Papstes gefeiert werden, nicht legitim sein können. In der pastoralen Praxis implizierte diese Überzeugung konkret, dass die lateinischen Missionare, die bei östlichen Christen tätig waren, keine „communicatio in sacris“ mit den so genannten Schismatikern pflegen durften. Um dieser Überzeugung Nachdruck zu verschaffen, hat die Römische Kongregation für die Glaubensverbreitung im Jahre 1729 ein Dekret erlassen, das die „communicatio in sacris“ für künftige Zeiten strikt verboten hat. Über dieses Dekret hat der Patrologe und Ostkirchenexperte Ernst Christoph Suttner mit Recht geurteilt, mit ihm sei das „Tischtuch zwischen den griechischen und den lateinischen Kirchen viel gründlicher“ zerschnitten worden als mit den Exkommunikationsbullen von 1054[13].
In der Folge haben auch die griechischen Patriarchen den katholischen Sakramenten ihre Gnadenhaftigkeit abgesprochen und im Jahre 1755 erklärt, dass sie die „Sakramente der Häretiker als verkehrt, als der apostolischen Überlieferung fremd und als Erfindungen verdorbener Menschen“ ansehen, „wenn sie nicht vollzogen werden, wie es der Hl. Geist den Aposteln auftrug und wie es die Kirche Christi bis auf den heutigen Tag hält“. Indem die Patriarchen weiter erklärten, dass sie „Konvertiten, die zu uns kommen,“ als „Ungeheiligte und Ungetaufte aufnehmen“, haben sie die sakramentalen Riten der Lateiner zu leeren Zeremonien erklärt, die keine Gaben des Heiligen Geistes vermitteln können. Und da Kirchen, in denen keine wirklichen Sakramente gefeiert werden, keine Kirche sein können, haben sich mit dieser Erklärung die griechischen Kirchen von der abendländischen Christenheit entschieden abgesetzt.
Der tiefere Grund für diese gegenseitige Verurteilung zwischen den griechischen und lateinischen Kirchen besteht darin, dass sich beide Seiten für die alleinige Kirche Jesu Christi gehalten haben und nicht mehr bereit gewesen sind, die andere Seite ebenfalls als Kirche Jesu Christi zu anerkennen. Da die seit Jahrhunderten zunehmende Entfremdung in der Kirche zwischen Ost und West im 18. Jahrhundert deshalb zur gegenseitigen Ablehnung geführt hat und keine Sakramentengemeinschaft mehr zugelassen worden ist, ist die Spaltung zu einer eigentlichen Konfessionsgrenze in dem Sinne eskaliert, dass sich die Überzeugung verfestigt hat, dass es eine katholische und eine orthodoxe Kirche in einem reinen Nebeneinander gäbe.
Zu einem grundlegenden Wandel im Sinne der Rückkehr zu der in der breiten Tradition wirksamen Auffassung im Verhältnis zwischen Griechen und Lateinern ist es erst im 20. Jahrhundert gekommen. Am Beginn einer neuen Situation hat die geschichsträchtige Begegnung zwischen dem Ökumenischen Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel und Papst Paul VI. in Jerusalem am 5. und 6. Januar 1964 gestanden. Der damit bekundete gegenseitige Wille zur Wiederherstellung der Liebe zwischen beiden Kirchen, der mit dem Bruderkuss besiegelt worden ist, steht vor unseren Augen als bleibende Ikone der Bereitschaft zur Versöhnung und zur Wiederherstellung der ekklesialen und eucharistischen Gemeinschaft.[14] Ohne diese Begegnung in Jerusalem wäre das ebenso historische Ereignis des 7. Dezember 1965 nicht möglich gewesen.
3. Bleibende Aufgaben im Versöhnungsprozess zwischen Ost und West
Beide Akte sind zum Ausgangspunkt für den ökumenischen Dialog der Liebe geworden, und mit ihnen ist bereits ein erster Schritt des Dialogs der Liebe erreicht worden. Der Dialog der Liebe verlangt aber von selbst nach dem Dialog der Wahrheit, nämlich der seriösen theologischen Aufarbeitung der bisher trennenden theologischen Differenzen, um wieder Kirchen- und Kommuniongemeinschaft zu ermöglichen. Die beiden Gestalten des ökumenischen Dialogs gehören dabei unlösbar zusammen. Der Dialog der Liebe bildet auf der einen Seite die Voraussetzung, um überhaupt einen Dialog der Wahrheit beginnen zu können. Auf der anderen Seite bleibt aber der Dialog der Wahrheit darauf angewiesen, vom Dialog der Liebe begleitet zu werden. In beiderlei Hinsicht sollen deshalb in einem dritten Durchgang Hinweise auf den weiteren Versöhnungsprozess in der Kirche zwischen Ost und West gegeben werden.
a) Verhältnis von Kirche und Staat
An erster Stelle hat der Blick in die Geschichte gezeigt, dass hinter den schwierigen Auseinandersetzungen zwischen Lateinern und Griechen, die bis zu Schismen geführt haben, zumeist politische Gründe gestanden haben. Von daher sollte in den ökumenischen Dialogen eine Frage angegangen und besprochen werden, die bisher kaum behandelt worden ist, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Politik und Glaube und zwischen Staat und Kirche. Eine diesbezügliche Untersuchung legt sich bereits deshalb nahe, da sich in der Kirche in Ost und West diesbezüglich sehr verschiedene Konzeptionen herausgebildet haben, die sich auf die Beziehungen zwischen Lateinern und Griechen massgeblich ausgewirkt haben.
Im abendländischen Römerreich hat es zwar ein ähnliches Verhältnis zwischen Kirche und Staat wie bei den Griechen gegeben; spätestens seit der Zeit des Reformpapsttums im 11. und 12. Jahrhundert hat sich die Situation aber stark geändert. Seither hat die Kirche im Westen in einer langen und verwickelten Geschichte lernen müssen – und hat die Lektion auch gelernt -, dass in der Trennung von Kirche und Staat bei gleichzeitiger Partnerschaft zwischen beiden Realitäten die adäquate Ausgestaltung ihres Verhältnisses besteht.
In den Kirchen des Ostens ist demgegenüber eine enge Verbindung zwischen der staatlichen Herrschaft und der kirchlichen Hierarchie dominierend geworden und bis heute geblieben, die als «Symphonie» von Staat und Kirche gekennzeichnet zu werden pflegt. Sie kommt vor allem zum Ausdruck in den orthodoxen Konzeptionen der Autokephalie und des kanonischen Territoriums. Diese Verhältnisbestimmung bringt es mit sich, dass die Orthodoxen Kirchen stark mit der jeweiligen Nation verbunden sind und deshalb als Nationalkirchen existieren. Ihre Stärke liegt von daher gewiss darin, dass sie in der jeweiligen Nation, in der die Gläubigen leben, inkulturiert sind. Ihre Gefährdung besteht allerdings darin, dass die Nationalkirchen nicht selten starke Tendenzen zum Nationalistischen und Ethnophysizistischen aufweisen, wie dies in extremer Weise in der politischen Konzeption des «Ruski mir» der Fall ist.
In den ökumenischen Diskussionen drängt sich die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat nicht nur wegen der schwerwiegenden politischen Hypotheken auf, mit denen die «Symphonie» von Staat und Kirche in einzelnen Kirchen im Osten wie vor allem in der Russisch-Orthodoxen belastet ist[15]. Eine Klärung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat legt sich vielmehr auch aus grundsätzlichen historischen und theologischen Überlegungen auf. Denn es macht einen grundlegenden Unterschied aus, ob man sich in der Geschichtsschreibung und in den ökumenischen Dialogen von einer reichsrechtlichen Ekklesiologie, in der die politische Kirchenordnung der Pentarchie von Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem im Vordergrund steht, leiten lässt, oder ob man sich an der apostolischen Ekklesiologie orientiert, in der die petrinischen Sitze von Rom, Alexandrien und Antiochien massgebend sind und in der nicht der Kaiserthron, sondern der römische Bischofssitz, und zwar aufgrund des Martyriums des heiligen Petrus in Rom, eine entscheidende Rolle spielt.[16]
b) Verhältnis von Glaube und Kultur
Die angesprochenen politischen Konflikte sind weitgehend auch dadurch bedingt, dass Lateiner und Griechen in verschiedenen Kulturen gelebt haben. Von daher ist es angezeigt, in den ökumenischen Dialogen auch das Verhältnis zwischen Glaube und Kultur zu bedenken, um neue Wege in die Zukunft zu beschreiten. Wenn die grossen Spaltungen in der Kirche in Ost und West ihre wesentlichen Ursachen in verschiedenen kulturellen Welten haben, dann darf man umgekehrt annehmen, dass die Begegnung und der Dialog zwischen den Kulturen einen wesentlichen Beitrag zur Verständigung und Versöhnung in der ökumenischen Christenheit darstellen.
Beim Bedenken des Verhältnisses zwischen Glaube und Kultur geht man am besten davon aus, dass der christliche Glaube selbst Kultur ist. Es gibt den christlichen Glauben nicht nackt, allein als Religion, sondern es kann ihn nur auch als Kultur geben. In diesem Sinne ist – falls dieser Vergleich erlaubt sei – der Glaube am ehesten dem Alkohol ähnlich, der für den Menschen nur zugänglich ist, wenn er nicht in der Form von hundert Prozent eingenommen wird, sondern mit anderen Substanzen eine Verbindung eingeht. In einem analogen Sinn ist auch die Botschaft des christlichen Glaubens kein chemisch reines und abstraktes Wort, sondern sie ist in vielfältigen interkulturellen Begegnungen geschichtlich gereift, in denen sie im Umgang mit den Menschen, mit der Welt und mit Gott eine kulturelle Gestalt des Lebens geformt hat und dies auch heute tut.
Für die ökumenische Versöhnung in der Kirche zwischen Ost und West ist es von grundlegender Bedeutung, dass der interkulturellen Begegnung und dem Dialog der Kulturen ein wichtiger Stellenwert gegeben wird. Da die verschiedenen Kulturen ihren authentischen Ausdruck vor allem in der jeweiligen Kunst, die sie hervorgebracht haben, finden, legt es sich nahe, Kunstausstellungen zu organisieren, um auf diesem Weg zwei verschiedene Kulturen miteinander ins Gespräch zu bringen. Als besonders geeignet erweist sich dabei die Aufführung von Konzerten und das gemeinsame Singen von Chören aus verschiedenen Kirchengemeinschaften. Denn die Musik ist zweifellos die universalste Sprache, die die Menschheit kennt und die Menschen miteinander zu verbinden vermag. Und in der Doxologie dürften mehr Gemeinsamkeiten sichtbar werden als allein in der Theologie.
Vor allem braucht der interkulturelle Dialog Christen, die in verschiedenen Kulturen leben, einander begegnen und einander besser kennen lernen und sich gegenseitig bereichern. In dieser Sinnrichtung hat zum Beispiel das Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen begonnen, Studienwochen zu organisieren, während denen junge katholische Theologen und Priester eine orthodoxe Kirchengemeinschaft besuchen und deren Repräsentanten begegnen und auf der anderen Seite junge orientalische Theologen und Priester nach Rom kommen, um die katholische Kirche besser und mit eigenen Augen kennen zu lernen. Ich sehe darin den wichtigsten Beitrag für die Versöhnung in der Kirche zwischen Ost und West in der Gegenwart und für die Vorbereitung einer guten Zukunft. Denn damit wird dem lernpsychologischen Grundgesetz entsprochen, dass Menschen weniger durch Informationen, wie gut sie auch sein mögen, sondern eher durch eigene Erfahrungen lernen und dass von der Geschichte überkommene und mit Vorurteilen belastete Emotionen am besten durch positive Gegenemotionen überwunden werden können. Denn der in den ökumenischen Begegnungen wichtige Dialog der Wahrheit vermag nur in ehrlicher und glaubwürdiger Offenheit geführt zu werden, wenn er vom Dialog der Liebe und des Lebens begleitet und unterstützt wird.
c) Freude am Austausch der Gaben
Damit ist anvisiert, was das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils «Unitatis redintegratio» als «Austausch der Gaben» im Prozess der ökumenischen Verständigung bezeichnet. Dahinter steht die Überzeugung, dass keine Kirche so reich ist, dass sie nicht der Bereicherung durch Gaben von anderen Kirchen bedürfte, dass aber auch keine Kirche so arm ist, dass sie nicht einen eigenen Beitrag in die ökumenische Gemeinschaft einzubringen vermöchte. Bei dieser gegenseitigen Bereicherung kann es nicht darum gehen, einen Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Es geht vielmehr darum, dass die Stärken der einen Seite mit den Stärken der anderen Seite ins Gespräch gebracht werden, um gegenseitig voneinander zu lernen.
Dies lässt sich wohl am besten konkret verdeutlichen an jenem Thema, das den orthodox-katholischen Dialog seit Jahrzehnten beschäftigt und weiterhin beanspruchen wird, nämlich das Verhältnis von Synodalität und Primatialität.[17] Um bei dieser schwierigen Frage weiterkommen zu können, müssen auf beiden Seiten Schritte aufeinander zu im Sinne einer gegenseitigen Lernbereitschaft gemacht werden, wie sie der orthodox-katholische Arbeitskreis St. Irenäus in seiner Studie „Im Dienst an der Gemeinschaft“ in synthetischer Weise ausgesprochen hat: „Vor allem müssen die Kirchen danach streben, ein besseres Gleichgewicht zwischen Synodalität und Primat auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens zu erreichen, und zwar durch eine Stärkung synodaler Strukturen in der katholischen Kirche und durch die Akzeptanz eines gewissen Primats innerhalb der weltweiten Gemeinschaft der Kirchen in der orthodoxen Kirche.“[18]
Die Katholische Kirche, die eine starke primatiale Tradition kennt, muss in der Tat eingestehen, dass sie in ihrem Leben und in ihren ekklesialen Strukturen noch nicht jenes Mass an Synodalität entwickelt hat, das theologisch möglich und notwendig wäre. Diesbezüglich betont Papst Franziskus mit Recht: «Im Dialog mit den orthodoxen Brüdern haben wir Katholiken die Möglichkeit, etwas mehr über die Bedeutung der bischöflichen Kollegialität und über ihre Erfahrung der Synodalität zu lernen. Durch einen Austausch der Gaben kann der Geist uns immer mehr zur Wahrheit und zum Guten führen.»[19] Dies gilt zumal im Blick auf die Synodalität auf der regionalen Ebene, die in den Orthodoxen Kirchen auf der Grundlage wichtiger Entscheidungen im Ersten Ökumenischen Konzil von Nicaea 325 und im Vierten Ökumenischen Konzil von Chalkedon 451 stark entwickelt ist. Auf dieser wie auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens die Synodalität zu verstärken, ist zweifellos der wichtigste Beitrag der Katholischen Kirche für die Anerkennung des Primats des Bischofs von Rom in der ökumenischen Gemeinschaft.[20]
Auf der anderen Seite wird man von den Orthodoxen Kirchen, die eine lange und starke synodale Tradition kennen, erwarten dürfen, dass sie im ökumenischen Dialog lernen, dass ein Primat auch auf der universalen Ebene nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist, dass er nicht im Gegensatz zur orthodoxen Ekklesiologie steht, sondern mit ihr kompatibel ist, wie der orthodoxe Metropolit John D. Zizioulas immer wieder betont hat[21], und dass auch die innerorthodoxen Spannungen es nahelegen, über ein Amt der Einheit auch auf der universalen Ebene nachzudenken, das freilich mehr sein müsste als ein reiner Ehrenprimat, sondern auch besondere rechtliche Kompetenzen einschliessen müsste.
In dieser Weise könnte als tragfähiger ökumenischer Konsens erarbeitet werden, dass die Kirche synodal und primatial zugleich ist, wie der deutsche Jesuitentheologe Medard Kehl das eigentliche Wesen der Kirche umschreibt: «Die Katholische Kirche versteht sich als das <Sakrament der Communio Gottes>, als solches bildet sie die vom Heiligen Geist geeinte, dem Sohn Jesus Christus zugestaltete und mit der ganzen Schöpfung zum Reich Gottes des Vaters berufene Gemeinschaft der Glaubenden, die synodal und <hierarchisch> zugleich verfasst ist.“[22] Bei dieser Definition kommt es entscheidend darauf an, wie dieses «zugleich» im kirchlichen Leben und in den ekklesialen Strukturen auf allen Ebenen der Kirche - lokal, regional und universal - in glaubwürdiger Weise realisiert wird.
4. Auf dem Weg zur vollen Kirchengemeinschaft
Dies sind nur einige wenige Hinweise, auf welchen Wegen die ökumenische Verständigung in der Kirche zwischen Ost und West vorankommen könnte. Von daher ist es angezeigt, abschliessend nochmals auf den Ausgang unserer Überlegungen zurückzukommen, nämlich auf die «Gemeinsame Erklärung» von Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras am 7. Dezember 1965. Indem beide in feierlicher wie rechtsverbindlicher Weise die tragischen Ereignisse von 1054 dem geschichtlichen Vergessen überantwortet haben, haben sie zugleich erklärt, dass diese nicht mehr zum amtlichen Bestand der Kirchen gehören. Damit ist zweifellos das giftige Element der Exkommunikation aus dem Organismus der Kirche gezogen und das «Symbol der Spaltung» durch das «Symbol der Liebe» ersetzt worden oder, wie der Theologe Joseph Ratzinger damals diesen Vorgang interpretiert hat: „Das Verhältnis der <erkalteten Liebe>, der <Gegensätze, des Misstrauens und der Antagonismen>, ist ersetzt durch die Beziehung der Liebe, der Brüderlichkeit, deren Symbol der Bruderkuss ist.“[23]
Da aber die Ereignisse von 1054 nicht die Trennung der Kirchen verursacht haben, konnte auch die «Gemeinsame Erklärung» von 1965 nicht das Ende der Trennung bedeuten. Ihr grosses Verdienst besteht jedoch darin, dass die Exkommunikationsbullen von 1054 nicht mehr jenes Gewicht haben können, das sie über lange Zeit in der Geschichte ausgeübt und damit die Beziehungen zwischen Lateinern und Griechen vergiftet haben.
Um die Trennung zu überwinden, müsste der erste Schritt darin bestehen, dass sich die Katholische und die Orthodoxe Kirche gegenseitig als Kirche anerkennen. Die Orthodoxen Kirchen haben auf ihrer Grossen Synode von Kreta im Jahre 2016 eine eingehende Diskussion darüber geführt, ob es ausserhalb der Orthodoxen Kirchen Kirche geben könne. Nach langen und kontroversen Diskussonnen hat die Synode das Problem mit dem Kompromiss zu lösen versucht, dass die Orthodoxe Kirche «die historische Benennung anderer, nicht orthodoxer Kirchen und Konfessionen, die nicht mit ihr in Gemeinschaft stehen», anerkennt, wobei die Einheit der Kirche «ihrer ontologischen Natur nach» niemals gestört werden kann.[24] Welche Konsequenzen aus diesen Aussagen die Orthodoxe Kirche im Blick auf die theologische Würdigung der Katholischen Kirche ziehen wird, dies muss ich freilich ihr überlassen.
Die Katholische Kirche hat bereits auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Kirchen des Ostens in besonderer Weise gewürdigt und sie in einer grundlegenden Gemeinschaft «zwischen Lokalkirchen als Schwesterkirchen» gesehen[25], weil bei ihnen das in Apostolischer Sukzession stehende Bischofsamt und alle gültigen Sakramente, insbesondere die Eucharistie, gegeben sind und sie damit über die wesentlichen Elemente verfügen, die sie als Einzelkirchen konstituieren. Vor allem in Würdigung der Kostbarkeit der heiligen Sakramente wird über die Kirchen des Ostens gesagt: «So baut sich auf und wächst durch die Feier der Eucharistie des Herrn in diesen Einzelkirchen die Kirche Gottes.»[26] Und im Blick auf eine mögliche Communicatio in sacris hält das Ökumenismusdekret fest: «Da nun diese Kirchen trotz ihrer Trennung wahre Sakramente besitzen, vor allem aber in der Kraft der apostolischen Sukzession das Priestertum und die Eucharistie, wodurch sie in ganz enger Verwandtschaft bis heute mit uns verbunden sind, so ist eine gewisse Gottesdienstgemeinchaft unter gegebenen geeigneten Umständen mit Billigung der kirchlichen Autorität nicht nur möglich, sondern auch ratsam.»[27]
Dabei kann es nicht genügen, dass sich Orthodoxe und Katholische Kirche als zwei verschiedene Kirchen anerkennen, wie dies in der noch immer üblichen Redeweise - «unsere beiden Kirchen» - zum Ausdruck kommt, dass beide Kirchen als zwei unterschiedliche Kirchengemeinschaften bezeichnet werden. Damit jedoch wird ein Plural von Kirchen behauptet, über dem der Singular Kirche nicht mehr erscheinen kann; und damit verbleibt, wie Joseph Kardinal Ratzinger mit Recht moniert, «auf der letzten Ebene des Kirchenbegriffs» ein «Dualismus» und wird die eine Kirche zu einer «Utopie» oder gar zu einem «Phantom», «während ihr doch gerade das Leibsein wesentlich ist»[28] und das Leibsein der Kirche aus sich selbst heraus auch zur verbindlichen Gemeinschaft im eucharistischen Leib des Herrn drängt.
Diese Konsequenz ist genauer darin begründet, dass in beiden Kirchengemeinschaften das ekklesiologische Grundgefüge erhalten geblieben ist, das sich seit dem Zweiten Jahrhundert herausgebildet hat, nämlich die sakramental-eucharistische und die episkopale Grundstruktur in dem Sinne, dass die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt in Apostolischer Sukzession als für das Kirchesein konstitutiv betrachtet werden.
In dieser gemeinsamen ekklesialen Grundstruktur gibt es aber ein wesentliches Element, das nach wie vor als strittig betrachtet wird, nämlich das unterschiedliche Verständnis des Amtes des Bischofs von Rom. Der eigentlich strittige Punkt besteht dabei darin, dass zwar auch die Orthodoxie den Bischof von Rom als Ersten in der Taxis der Sitze betrachtet, wie sie bereits das Konzil von Nicaea definiert hat, dass hingegen in katholischer Sicht die Formel grundlegend ist; «Der Papst ist Erster – und hat auch spezifische Funkionen und Aufgaben.»[29] Mit diesem Unterschied beschäftigt sich die Internationale Gemischte Kommission für den theologischen Dialog zwischen der Katholischen und Orthodoxen Kirche seit Jahrzehnten und muss ihn weiter vertiefen.
Eine gegenseitige Anerkennung als Kirche ist der erste Schritt zur Erklärung von Kirchengemeinschaft. Ihm muss aber der zweite Schritt folgen, nämlich die Wiederaufnahme der Kommuniongemeinschaft. Denn dort, wo die geschwisterliche Liebe – Agape – in einem ernsthaften Sinn als ekklesiale Realität gegeben ist, muss sie, um glaubwürdig sein zu können, auch eucharistische Liebe werden. Diese Sinnbestimmung hat der Ökumenische Patriarch Athenagoras bereits im Jahre 1968 in einem Telegramm an Papst Paul VI. mit diesen deutlichen Worten zum Ausdruck gebracht: «Die Stunde des christlichen Mutes ist gekommen, Wir lieben einander; wir bekennen den gleichen gemeinsamen Glauben; machen wir uns zusammen auf den Weg vor die Herrlichkeit des gemeinsamen heiligen Altars, um den Willen des Herrn zu erfüllen, damit die Kirche strahlt, damit die Welt glaubt und der Friede Gottes auf alle kommt.»[30]
Erst mit der Wiederaufnahme der eucharistischen Gemeinschaft wird die ungeteilte Kirche in Ost und West wiederhergestellt sein, was doch das eigentliche Ziel aller ökumenischen Bemühungen ist, die mit dem wichtigen Schritt am 7. Dezember 1965 verheissungsvoll begonnen worden sind.
[1] Vgl. Métropolite Emmanuel de France / Cardinal Kurt Koch, L´esprit de Jérusalem. L´orthodoxie et le catholicisme au XXIeme siècle (Paris 2014).
[2] Déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras le 7 décembre 1965, dans: Tomos Agapis. Vatican – Phanar (1958-1970) (Rome – Istanbul 1971) 278-282 (Nr. 127).
[3] Vgl. H. Destivelle, Pour une théologie du dialogue de la charité. La signification ecclesiologique de la levée des anathèmes de 1054, dans: Idem, Conduis-la vers l´unité parfaite. Oecuménisme et synodalité (Paris 2018) 35-65.
[4] G. Larentzakis, Kein Schisma, trotzdem getrennt, in: Die Tagespost vom 27. Juni 2021.
[5] Y. Congar, Neuf cents après. Notes sur le «schisme oriental”, 1054-1954, dans: Idem, L´Église et les Églises. Neuf siècles de douloureuse séparation entre l´Orient er l´Occident (Chevetogne 1954) 3-95.
[6] Vgl. Y. Congar, Zerstrittene Christenheit. Wo trennten sich Ost und West (Wien 1959).
[7] W. Kardinal Kasper, Wege der Einheit. Perspektiven für die Ökumene (Freiburg i. Br. 2005) 208.
[8] H.-J. Schulz, Die Ausformung der Orthodoxie im byzantinischen Reich, in: W. Nyssen, H.-J. Schulz und P. Wiertz (Hrsg.), Handbuch der Ostkirchenkunde. Band I (Düsseldorf 1984) 49-132, zit 99.
[9] Vgl. G. Maspero, Rethinking the Filioque with the Greek Fathers (Michigan 2023).
[10] Vgl. A. Arjakovsky / B. Hallensleben (éd.), Le Concile de Florence (1438/39) – une relecture oecuménique = Studia Oecumenica Friburgensia 99 (Münster 2021).
[11] Vgl. F. Dvornik, Le Schisme de Photius. Histoire et Légende (Paris 1950).
[12] Y. Congar, Zerrissene Christenheit. Wo trennten sich Ost und West (Wien 1959) 111.
[13] E. Ch. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte (Würzburg 1996) 90.
[14] Vgl. Dialogue of Love. Breaking the Silence of Centuries, Ed. by John Chryssavgis (New York 2014); V. Martano, L´Abbraccio di Gerusalemme. Cinquant´anni fa lo storico incontro tra Paolo VI e Athenagoras (Milano 2014).
[15] Vgl. J. Oeldemann, Kaum noch zukunftsfähig? Krieg in der Ukraine: Ende des „byzantinischen“ Modells, in: KNA - Ökumenische Information. Dokumentation vom 22. März 2022, I-III, zit. I.
[16] Vgl. St. O. Horn / M. Trimpe / V. Twomey, Der Römische Primat – angefragt in Zeiten des Umbruchs. Nicäa, Konstantinopel, Chalcedon und Reformation in England (Sankt Ottilien 2024).
[17] Vgl. K. Kardinal Koch, Auf dem Weg zur Wiederherstellung der einen Kirche in Ost und West, in: D. Schon (Hrsg.), Dialog 2.0 – Braucht der orthodox-katholische Dialog neue Impulse? (Regensburg 2017) 19-41.
[18] Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken. Eine Studie des Gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreises St. Irenäus (Paderborn 2018) 94.
[19] Franziskus, Evangelii Gaudium, Nr. 246.
[20] Vgl. The Bishop of Rome. Primacy and Synodality in the ecumenical dialogues and in the responses to the Encyclical Ut Unum Sint.. A Study Document of the Dicastery for Promoting Christiasn Unitay = Collana Ut Unum Sint 7 (Cittáà del Vaticano 2024).
[21] J. D. Zizioulas, Being as Communion (New York 1985); Idem, The One and the Many. Studies on God, the Church and the World Today (Alhambra 2010).
[22] M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie (Würzburg 1992) 51.
[23] J. Kardinal Ratzinger, Rom und die Kirchen des Ostens nach der Aufhebung der Exkommunikationen von 1054, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (München 1982) 214-230, zit. 229.
[24] B. Hallensleben (Hrsg.), Einheit in Synodalität. Die offiziellen Dokumente der Orthodoxen Synode auf Kreta 18. bis 26. Juni 2016 (Münster 2016) 79.
[25] Unitatis redintegratio, Nr. 14.
[26] Unitatis redintegratio, Nr. 15.
[27] Unitatis redintegratio, Nr. 15.
[28] Briefwechsel zwischen Metropolit Damaskinos und Joseph Cardinal Ratzinger, in: J. Cardinal Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio (Augsburg 2002) 187-209, zit. 205.
[29] Benedikt XVI., Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald (Freiburg i. Br. 2010) 114.
[30] Télegramme du patriarche Athénagoras au pape Paul VI, à l´occasion de l´anniversaire de la levée des anathèmes le 7 décembre 1969, in: Tomos Agapis. Vatican - Phanar (1958-1970) (Rome – Istanbul 1971) 603 (Nr. 277).