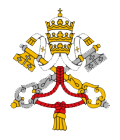«DER BISCHOF VON ROM»
Einführung in das Studiendokument des Dikasteriums zur Förderung
der Einheit der Christen
Kurt Cardinal Koch
Paderborn, 2 April 2025
Die Suche nach einer ökumenischen Verständigung über das Amt des Bischofs von Rom muss, jedenfalls in katholischer Sicht, von einer doppelten Feststellung ausgehen: Auf der einen Seite ist die Katholische Kirche im Glauben überzeugt, dass der Einheitsdienst des Petrusnachfolgers ein kostbares Geschenk des Heiligen Geistes für die Kirche ist, das sie deshalb nicht für sich behalten darf, sondern verpflichtet ist, dieses Geschenk auch den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften anzubieten und zu teilen. Denn ohne Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom ist in katholischer Sicht eine sichtbare Einheit der Kirche nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite muss die Katholische Kirche aber zur Kenntnis nehmen, dass von vielen anderen christlichen Gemeinschaften die Frage des Papstamtes als grosses Hindernis auf dem Weg zur Wiederherstellung der Einheit der Christen wahrgenommen wird. Es macht das Verdienst von Papst Paul VI. aus, dass er beim Besuch im damaligen Sekretariat für die Einheit der Christen im Jahre 1967 in freimütiger und ehrlicher Weise ausgesprochen hat, dass die Frage des Papstamtes eines der schwierigsten ökumenischen Probleme darstellt: «Der Papst ist, wir wissen es wohl, ohne Zweifel das schwerwiegendste Hindernis auf dem Weg des Ökumenismus.»[1]
Von daher stellt sich die Frage, wie diese gegensätzlichen Wahrnehmungen überwunden werden können und was zu tun ist, damit der Dienst des Petrusnachfolgers nicht mehr als ein Hindernis bei der Suche nach der Wiederherstellung der Einheit der Kirche betrachtet wird, sondern als ökumenische Möglichkeit oder gar Hilfe eingeschätzt werden kann. Es muss sich dabei von selbst verstehen, dass diese Frage nicht im Alleingag, sondern nur in den ökumenischen Dialogen gemeinsam beantwortet werden kann. Im Sinne eines ersten Schrittes ist von der Beobachtung auszugehen, dass und wie die Inhaber des Petrinischen Dienstes selbst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ihr Amt in einer ökumenischen Perspektive betrachtet und ausgeübt haben.
Päpstliche Einladungen zum ökumenischen Gespräch über das Papstamt
Auf dem eingangs genannten doppelten Hintergrund hat Papst Johannes Paul II. die Bitte an die eigene Kirche und an die gesamte Ökumene ausgesprochen, sich mit ihm auf einen geduldigen brüderlichen Dialog über den Primat des Bischofs von Rom einzulassen, und zwar mit dem Ziel, eine Form der Primatsausübung zu finden, «die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet», genauer dahingehend, dass dieses Amt «einen von den einen und den anderen anerkannten Dienst der Liebe zu verwirklichen vermag»[2]. Diese Bitte findet sich im Schlussteil seiner Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene «Ut unum sint» im Jahre 1995 formuliert, in dem er grundlegende Gedanken dem «Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit» gewidmet hat.
Um diese Bitte richtig einordnen zu können, muss man sich die Grundüberzeugung, von der Papst Johannes Paul II. in seinem ökumenischen Wirken getragen gewesen ist, vergegenwärtigen, dass nämlich nach dem Ersten Jahrtausend der Christentumsgeschichte, das die Zeit der ungeteilten Kirche gewesen ist, und nach dem Zweiten Jahrtausend, das im Osten wie im Westen zu tiefen Spaltungen in der Kirche geführt hat, das Dritte Jahrtausend die grosse Aufgabe zu bewältigen hat, die verloren gegangene Einheit der Christen wiederherzustellen. In dieser ökumenischen Selbstverpflichtung hat er in seiner Enzyklika auf das ehrliche Bekenntnis von Papst Paul VI. zurückgegriffen und erklärt, dass das Amt des Bischofs von Rom „eine Schwierigkeit für den Grossteil der anderen Christen“ darstellt, „deren Gedächtnis durch gewisse schmerzliche Erinnerungen gezeichnet ist“[3]. Papst Johannes Paul II. ist aber überzeugt gewesen, dass das Amt, das dem Nachfolger des Petrus übertragen ist, in erster Linie ein Amt der Einheit ist und dass es im Bereich der Ökumene „seine ganz besondere Erklärung“ findet[4].
Die von Papst Johannes Paul II. vorgenommene Unterscheidung zwischen dem Wesen des Primats des Bischofs von Rom und der konkreten Form seiner Ausübung hat Papst Benedikt XVI. verschiedentlich aufgegriffen und die damit verbundene Einladung an die Ökumene erneuert. So hat er beispielsweise bei seiner Begegnung mit Vertretern von Orthodoxen Kirchen in Freiburg i. Br. im September 2011 betont: „Wir wissen, dass es vor allem die Primatsfrage ist, um deren rechtes Verständnis wir weiter geduldig und demütig ringen müssen. Ich denke, dabei können uns die Gedanken zur Unterscheidung zwischen Wesen und Form der Ausübung des Primates, die Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika Ut unum sint (Nr. 95) vorgenommen hat, weiterhin fruchtbare Anstösse geben.“[5] Bereits als Theologe hatte er in den siebziger Jahren den weitsichtigen Vorschlag unterbreitet, Rom müsse für die Wiedervereinigung vom Osten „nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde“[6].
Den von seinen Vorgängern bereiteten Weg geht auch Papst Franziskus in ökumenischer Offenheit weiter, indem er freimütig eingesteht, dass wir auf dem Weg der Unterscheidung zwischen dem, was für den Primat des Papstes wesentlich ist, und dem, was zur konkreten und teilweise geschichtlich bedingten Form seiner Ausübung gehört, bisher «wenig vorangekommen» sind[7]. Sein spezifischer Beitrag zur Vertiefung dieser Frage besteht vor allem darin, dass er die Synodalität als «konstitutive Dimension der Kirche» und damit auch als den «geeignetsten Interpretationsrahmen für das Verständnis des hierarchischen Dienstes selbst» betrachtet und deshalb überzeugt ist, dass die Ausübung des petrinischen Dienstes in einer synodalen Kirche besser geklärt werden kann, und zwar in dieser Sinnrichtung: „Der Papst steht nicht allein über der Kirche, sondern er steht in ihr als Getaufter unter den Getauften, im Bischofskollegium als Bischof unter den Bischöfen und ist – als Nachfolger des Apostel Petrus – zugleich berufen, die Kirche von Rom zu leiten, die in der Liebe allen Kirchen vorsteht.“[8] Zumal in ökumenischer Hinsicht hat Papst Franziskus seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass eine „sorgfältige Untersuchung, wie im Leben der Kirche das Prinzip der Synodalität und der Dienst dessen, der den Vorsitz hat, zum Ausdruck kommen“, einen wichtigen Beitrag zur ökumenischen Versöhnung zwischen den Kirchen darstellt[9].
Antworten aus der Ökumene auf die päpstlichen Einladungen
Auf die zuerst von Papst Johannes Paul II. ausgesprochene Einladung sind anschliessend verschiedene Antworten eingegangen, und zwar sowohl von anderen Kirchen als auch von ökumenischen Kommissionen und ebenso von akademischen Institutionen. Nach fünf Jahren hat das Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn dankenswerterweise eine erste Auswertung vorgenommen[10], so dass dessen Forschungsbericht im Jahre 2001 der Vollversammlung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen vorgelegt werden konnte. Der 25. Jahrestag der Veröffentlichung der Enzyklika «Ut unum sint» im Jahre 2020 hat einen neuen Anstoss gebildet, die Fragestellung wieder aufzugreifen. Das Ergebnis einer ungefähr drei Jahre dauernden Arbeit stellt das Studiendokument des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen mit dem Titel «Der Bischof von Rom. Primat und Synodalität in den ökumenischen Dialogen und Antworten auf die Enzyklika <Ut unum sint>» dar.[11]
Bei der Erarbeitung des Dokumentes waren nicht nur die Mitarbeiter des Dikasteriums involviert, sondern auch alle Mitglieder und Konsultoren des Dikasteriums, die während zwei Vollversammlungen das Thema diskutiert haben. Konsultiert wurden auch bedeutende katholische Experten wie auch zahlreiche orthodoxe und protestantische Fachtheologen. Anschliessend wurde der Text den verschiedenen Dikasterien der Römischen Kurie und dem Generalsekretariat der Bischofssynode zugestellt. Berücksichtigt wurden bei der Überarbeitung insgesamt fünfzig schriftliche Beiträge.
Nach dieser intensiven Beratung hat Papst Franziskus seine Zustimmung zur Publikation gegeben. Der Text ist aber kein Dokument des kirchlichen Lehramtes, sondern ein Studiendokument, das das Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen verantwortet. Es beansprucht nicht, das Thema vollumfänglich zu behandeln, und es fasst auch nicht den Standpunkt des kirchlichen Lehramtes zusammen. Sein Ziel besteht vielmehr darin, die wichtigsten Entwicklungen der offiziellen und inoffiziellen ökumenischen Diskussion über das Thema zusammenfassend zu präsentieren. Der ökumenisch Kundige wird bald feststellen, dass sich in dem Dokument viele Einsichten finden, die bereits gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts in verschiedenen ökumenischen Dialogen über das Amt des Bischofs von Rom besprochen worden sind.[12] Das Anliegen des Studiendokumentes besteht vor allem darin, diese Einsichten zusammen mit neueren ökumenischen Dialogergebnissen wieder aufzugreifen und zu einer Synthese zusammenzuführen. Und am Schluss des Dokumentes findet sich ein kleinerer Vorschlag des Dikasteriums mit dem Titel «Auf dem Weg zur Ausübung des Primats im 21. Jahrhunderts», in dem die wichtigsten in den bisherigen ökumenischen Dialogen über eine erneuerte Ausübung des Einheitsdienstes des Bischofs von Rom enthalten sind.
Wichtige ökumenische Fragestellungen
Um in die vorgesehene Diskussion einzuführen, ist es nicht notwendig, eine detaillierte Darstellung des Inhalts des Studiendokumentes zu bieten. Diese Aufgabe hat Johannes Oeldemann bereits in ausführlicher Weise in der «Ökumenischen Rundschau» wahrgenommen, wofür ich dankbar bin.[13] Es legt sich vielmehr nahe, den Schwerpunkt der Darlegungen auf die wichtigsten ökumenisch offenen Fragestellungen zu legen, die vor allem im zweiten Kapitel des Dokumentes behandelt werden.
An erster Stelle wird die biblische Sicht von der Person und der Aufgabe des Petrus im Zwölferkreis thematisiert. Im Blick auf die biblischen Grundlagen des petrinischen Dienstes wird in den ökumenischen Dialogen eine neue Leseart der sogenannten «Petrus-Texte» in der Heiligen Schrift vorgeschlagen, die in der Vergangenheit ein grosses Hindernis für die Annahme eines Einheitsdienstes auf der universalen Ebene der Kirche dargestellt haben. Um eine neue Sicht zu ermöglichen, wird den Dialogpartnern in den christlichen Kirchen zugemutet, anachronistische Rückprojektionen von späteren Lehrentwicklungen zu vermeiden und in frischer Weise die Sendung des Petrus unter den Aposteln neu zu betrachten. Als Brücken für ein neueres Verständnis werden dabei vor allem die Frage nach einer so genannten «petrinischen Funktion» und das biblische Verständnis von Autorität als Dienst (diakonia) hervorgehoben.
Das zweite wichtige Problem bezieht sich auf die Frage, ob das Petrusamt zum Wesen der Kirche gehört und es sich deshalb um eine Institution des göttlichen Rechts (de iure divino) handelt, oder ob es eine menschliche Institution darstellt, die aus praktischen Gründen, zumal in einer globalisierten Welt, als sinnvoll oder gar notwendig erscheint (de iure humano). Nach katholischer Lehre ist der Primat des Bischofs von Rom durch göttliches Recht eingesetzt worden und gehört deshalb zur wesentlichen und bleibenden Struktur der Kirche. Die in verschiedenen ökumenischen Dialogen vorgenommenen «hermeneutischen Klarstellungen» haben aber dazu beigetragen, die traditionelle Dichotomie von göttlichem und menschlichem Recht in eine neue Perspektive zu rücken, und zwar dahingehend, dass der Primat des Bischofs von Rom sowohl als göttliches als auch als menschliches Recht betrachtet werden kann. Da wir das ius divinum nur in jeweils geschichtlichen Vermittlungsformen wahrnehmen können, wird in den ökumenischen Dialogen vorgeschlagen, zwischen dem theologischen Wesen und der historischen Kontingenz des Primats des Bischofs von Rom zu unterscheiden, zumal die Primatsausübung «in jeder geschichtlichen Epoche von der <necessitas ecclesiae> abhängt». Der Primat des Petrus kann in dieser Optik als «Teil des Willens Gottes für die Kirche» betrachtet werden, der aber durch die menschliche Geschichte vermittelt wird. Dahinter steht die Überzeugung, dass in den zwischenkirchlichen Beziehungen in der Vergangenheit viele Wunden nicht aufgrund des theologischen Wesens, sondern der kontingenten Art der Ausübung des Primats und damit zusammenhängend auch aufgrund von persönlichem Versagen von Amtsträgern geschlagen worden sind. Mit dem Ziel einer «Heilung der Erinnerungen» werden deshalb gemeinsame historische Studien vorgeschlagen.
Von daher wendet sich das Dokument in einem dritten Schritt den so genannten Papstdogmen des Ersten Vatikanischen Konzils zu, nämlich der Definition des universalen Jurisdiktionsprimates des Papstes und seiner Unfehlbarkeit. Dass diese Dogmen auch heute noch zu den grossen Hindernissen gehören, dokumentieren auch die ersten Reaktionen auf das Studiendokument, die Pro Oriente aus orientalisch-orthodoxer, orthodoxer und evangelischer Sicht veröffentlicht hat.[14] Um die mit diesen Dogmen gegebenen Probleme anzugehen und möglichst zu überwinden, ist in den ökumenischen Dialogen vor allem der Weg beschritten worden, die Papstdogmen des Ersten Vatikanischen Konzils im Licht ihres historischen Kontextes, ihrer Zielsetzung und ihrer Rezeption zu interpretieren. Da die dogmatischen Definitionen des Konzils weitgehend von den historischen Umständen geprägt gewesen sind, wird in den ökumenischen Dialogen vorgeschlagen, nach neuen Ausdrucksformen zu suchen, die der ursprünglichen Intention treu bleiben, aber in eine Ekklesiologie der Communio integriert werden. Unter Bezugnahme auf die wichtigen Arbeiten von bedeutenden katholischen Theologen wie Yves Congar, Walter Kasper und Joseph Ratzinger wird eine Relecture oder Re-Rezeption der Papstdogmen des Ersten Vatikanischen Konzils angeregt, und zwar in der Überzeugung, dass eine Neuinterpretation des Ersten Vatikanischen Konzils einen wichtigen Schlüssel für die Anerkennung des Primats des Bischofs von Rom darstellen wird.
Perspektiven für die Ausübung des petrinischen Dienstes
Eine der bedeutendsten Früchte der ökumenischen Dialoge besteht darin, dass die Notwendigkeit eines Einheitsdienstes auch auf der universalen Ebene der Kirche eingesehen wird, auch wenn die theologischen Fundamente dieses Dienstes und die konkreten Weisen seiner Ausübung verschieden interpretiert werden. Doch im Unterschied zu den Polemiken in der Vergangenheit wird die Frage des Primates des Bischofs von Rom nicht mehr nur als ein ökumenisches Problem, sondern auch als eine günstige Gelegenheit für eine gemeinsame Reflexion über die Natur der Kirche und ihre Sendung in der Welt betrachtet. Von daher ergeben sich einige weitere Perspektiven für die Ausübung des Petrusamtes in der heutigen Zeit.
Eine erste Perspektive besteht in der Orientierung an der Ausübung des Primates des Bischofs von Rom im Ersten Jahrtausend, ohne dieses freilich zu idealisieren. Bei dieser Orientierung jedoch wird sichtbar, dass die Kirche in den Anfängen auf die Apostolischen Sitze gegründet gewesen ist, bei denen eine bestimmte Reihenfolge anerkannt gewesen ist und bei denen Rom der erste Sitz zugekommen ist.[15] Von daher wird in verschiedenen ökumenischen Dialogen die Notwendigkeit eines Primats auf der universalen Ebene der Kirche anerkannt und diese Aufgabe Rom zugesprochen.
Eine zweite Perspektive zielt auf eine deutlichere Unterscheidung zwischen den verschiedenen Verantwortungsbereichen beim Dienst des Bischofs von Rom. In den ökumenischen Dialogen wird vor allem unterschieden zwischen der Stellung des Bischofs von Rom in der Lateinischen Kirche, die man als patriarchales Amt umschreiben kann, und seinem primatialen Dienst an der Einheit in der Gemeinschaft der Kirchen sowohl im Westen als auch im Osten. Ein besonderer Akzent wird dabei darauf gelegt, dass der Papst in erster Linie Bischof von Rom als der seiner Hirtensorge anvertrauten Ortskirche ist, womit sein bischöfliches Amt hervorgehoben wird.
Drittens wird auf eine gegenseitige Interdependenz von Primat und Synodalität in dem Sinne abgehoben, dass der Primat synodal ausgeübt werden soll und dass es keine Synodalität ohne Primat geben kann. Diese Interdependenz zeigt auch in der ökumenischen Diskussion ihre besondere Bedeutung, da sie in allen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften betont und gelebt wird, freilich in recht unterschiedlichen Weisen, hinsichtlich derer man gegenseitig voneinander lernen kann, wie die Symposien in eindrücklicher Weise gezeigt haben, die in Rom zur Vorbereitung der Bischofssynode in der Katholischen Kirche über Theorie und Praxis der Synodalität in verschiedenen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften durchgeführt worden sind.[16] Eine solche gegenseitige Lernbereitschaft ist in erfreulicher Weise auch vom Gemeinsamen Orthodox-Katholischen Arbeitskreis St. Irenäus in seiner im Jahre 2018 veröffentlichten Studie „Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken“ formuliert worden, indem er Handlungsbedarf in beiden Kirchen feststellt: „Das Fehlen einer gemeinsamen orthodoxen Position zum Primat auf der universalen Ebene erschwert den orthodox-katholischen Dialog in dieser Hinsicht ebenso wie das Fehlen einer klaren Synodalstruktur in der katholischen Kirche.“[17]
Da die Interdependenz von Synodalität und Primat auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens - lokal. regional und universal - vollzogen werden muss, werden in den ökumenischen Dialogen viertens die gemeinschaftliche, kollegiale und personale Dimension unterschieden und in der Folge das Zusammenwirken von „allen, einigen und einem“ betont. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Zusammenspiel zwischen der Vielheit der Ortskirchen und der Einheit der Universalkirche zu. Denn wenn die universalkirchliche Dimension nicht oder nur marginal im Blick ist, kann die Notwendigkeit eines Primates auf der universalen Ebene der Kirche nicht, jedenfalls nicht in genügender Weise, einsichtig gemacht werden.
Auch diesbezüglich ist eine gegenseitige Lernbereitschaft angezeigt. Auf der einen Seite hat die Katholische Kirche angesichts einer in der Vergangenheit wirksamen universalistischen Einheitsekklesiologie den Plural „Kirchen“ neu lernen müssen und hat ihn auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gelernt, wobei ein besonderes Defizit an Synodalität auf der regionalen Ebene festgestellt werden muss. Auf der anderen Seite wird man von den Orthodoxen Kirchen, die eine starke Ortskirchentheologie vertreten und leben, erwarten dürfen, dass sie zu einer grösseren Offenheit für die universale Dimension der Kirche finden und dass sie ihrerseits im ökumenischen Dialog lernen, dass ein handlungsfähiger Primat auch auf der universalen Ebene der Kirche nicht nur möglich und theologisch legitim, sondern auch ekklesiologisch und besonders ökumenisch notwendig ist. Noch mehr dürfte diese Lernbereitschaft von den aus den Reformationen des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gelten, da die konfessionellen Weltbünde eben Bünde sind und sich höchstens auf dem Weg zu einer universalen Kirchengemeinschaft befinden.
Ohne die theologische Klärung des Verhältnisses zwischen der Vielheit der Ortskirchen und der Einheit der Universalkirche dürfte es schwierig sein, eine adäquate Antwort auf die Frage nach der Bedeutung eines Ersten Bischofs in der Gesamtkirche zu finden. Als ebenso wichtig erweist sich die Frage, ob ein personales Bischofsamt konstitutiv zum Wesen der Kirche gehört oder ob eine wie auch immer begründete „episkope“ allein nach menschlichem Recht und damit vor allem funktional betrachtet wird. Denn ein ökumenischer Dialog über den Bischof von Rom, ohne sich die Frage nach dem ekklesialen Stellenwert des Bischofsamtes überhaupt zu stellen, würde einen wesentlichen Aspekt ausblenden.
Das Studiendokument schliesst mit einem kurzen Vorschlag, der von der Vollversammlung des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen angenommen worden ist und in dem verschiedene Perspektiven aus den ökumenischen Dialogen aufgenommen sind. Beide Texte werden nun an die verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften weitergeleitet und um deren Antwort gebeten. Auf der Grundlage der eingehenden Reaktionen werden wir im Dikasterium beraten, wie diese wichtige ökumenische Frage weiterverfolgt werden kann.
[1] Dokumentiert in: AAS 59 (1967) 498.
[2] Johannes Paul II., Ut unum sint, Nr. 95.
[3] Johannes Paul II., Ut unum sint, Nr. 88.
[4] Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten (Hamburg 1994) 181.
[5] Benedikt XVI., Ansprache bei der Begegnung mit Vertretern der Orthodoxen Kirchen in Freiburg i. Br. am 24. September 2011.
[6] J. Kardinal Ratzinger, Die ökumenische Situation – Orthodoxie, Katholizismus und Reformation, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre (München 1982) 203-214, zit. 209.
[7] Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 32.
[8] Franziskus, Ansprache bei der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode am 17. Oktober 2015.
[9] Franziskus, Ansprache an die ökumenische Delegation des Patriarchats von Konstantinopel am 27. Juni 2015.
[10] Der Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit der Christen. Reaktionen auf die Einladung des Papstes zum Dialog über die Primatsausübung nach Ut unum sint 1995. Forschungsbericht, in: Catholica 55 (2001) 269-309.
[11] The Bishop of Rome. Primacy and Synodality in the ecumenical dialogues and the responses to the Encyclical UT UNUM SINT. A Study Document of the Dicastery for Promoting Christian Unity = Collana UT UNUM SINT 7 (Città del Vaticano 2024).
[12] Vgl. beispielsweise M. Hardt, Papsttum und Ökumene. Ansätze eines Neuverständnisses für einen Papstprimat in der protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts = Beiträge zur ökumenischen Theologie 20 (Paderborn 1981).
[13] J. Oeldemann, Auf dem Weg zu einer neuen Form der Primatsausübung. Ökumenische Impulse eines vatikanischen Studiendokumentes über den Bischof von Rom, in: Ökumenische Rundschau 74 (2025) 55-67.
[14] Der Bischof von Rom – Ökumenische Perspektiven, in: Pro Oriente, ÖkumeneMagazion (No 3 / 2024).
[15] Vgl. St. O. Horn / M. Trimpe / V. Twomey, Der Römische Primat – angefragt in Zeiten des Umbruchs. Nizäa, Konstantinopel, Chalcedon und Reformation in England = Theologische Orient&Okzident-Studien 7 (Sankt Ottilien 2024).
[16] Vgl. Listening to the East. Synodality in Eastern and Oriental Othodox Church Traditions. Ed. by Institute for Ecumenical Studies of the Angelicum / Pro Oiente Foundation = Collana UT UNUM SINT 4 (Città del Vaticano 2023); Listening to the West. Synodality in Western Ecclesial Traditions. Ed. by Institute for Ecumenical Studies of the Angelicum = Collana UT UNUM SINT 5 (Città del Vaticano 2024).
[17] Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken. Eine Studie des Gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreises St. Irenäus (Paderborn 2018) 90.