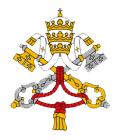Ein Kommentar
zum Zweiten Bericht
der Internationalen Römisch-Katholisch -
Altkatholischen Dialogkommission
2016
Gerhard Ludwig Kard. Müller
Die seit 2004 bestehende offizielle Dialogkommission hat nun in Weiterführung ihres Ersten Berichtes aus dem Jahre 2009 (=KuKg I) den (mit ergänzenden und weiterführenden Überlegungen) angereicherten Zweiten Dialog-Bericht (=KuKgII) vorgelegt.
Dankenswerterweise ist KuKg II abgedruckt zusammen mit KuKg I und ergänzt mit den wichtigsten offiziellen altkatholischen Erklärungen zum Primat des Papstes von 1871-1981 sowie den Stellungnahmen zu KuKg I. Der Text von KuKg II (Nr. 1-94 + Vorwort und Ausblick) umfasst die Seiten 95-156 des im Bonifatius-Verlag erschienenen Buches mit dem Titel: "Kirche und Kirchengemeinschaft. Erster und Zweiter Bericht der Internationalen Römisch-Katholisch - Altkatholischen Dialogkommission 2009 und 2016, Paderborn 2017.
KuKg II diskutiert drei Themen:
1. Die offenen Fragen zur Ekklesiologie, insofern im Rahmen einer Communio-Ekklesiologie das Verständnis des päpstlichen Lehr- und Jurisdiktionsprimats im Verhältnis von Ortskirche und Universalkirche vertieft werden soll. (S. 97- 119).
2. Die offenen Fragen zu den Mariendogmen von 1854 (Maria Immaculata) und 1950 (Maria Assumpta). (S. 119-132)..
3. werden spezifisch altkatholische Erläuterungen vorgelegt (3.1) zur Ordination von Frauen zum priesterlichen Dienst von Bischof, Priester/Presbyter und Diakon und (3.2) zur "inneren Zusammengehörigkeit von Eucharistie- und Kirchengemeinschaft" (S. 132-152), wobei bei dem letzeren Thema nur inneraltkatholisch eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis besteht, dies aber eine nicht unbeträchtliche Spannung in den Dialog mit der katholischen Kirche hineinträgt.
Die Eigenart des altkatholisch-katholischen Dialogs
Im Nachwort zum Gesamttext und Ausblick (S. 153- 156) wird hingewiesen auf die Besonderheit des Verhältnisses zwischen der altkatholischen Kirche der "Utrechter Union der Altkatholischen Kirchen" (seit 1889) und der "katholischen Kirche, die vom Papst und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird (Lumen gentium 8).
Die seit dem Widerspruch einzelner Katholiken, die sich dann später als altkatholische Kirche konstituiert haben, gegen das I. Vatikanum entstandene "Entfremdung und Trennung" (S. 153) ist in der Tat unvergleichbar mit der abendländischen und morgenländischen Kirchentrennung (1054) und der Entstehung der protestantischen Gemeinschaften (1517) mit ihrem nicht-sakramentalen Verständnis von Kirche überhaupt. Der Widerspruch bezieht sich hier hauptsächlich auf einzelne Dogmen um das Papsttum und die Stellung Mariens im Heilsgeheimnis, während die ekklesiologische Grundhermeneutik im bisherigen Sinne der abendländische Theologie "katholisch" blieb. Insofern kann man die Charakterisierung der Konflikte als eine Art "Familienzwist" (KuKg Nr. 23; S. 156) durchaus mit vollziehen.
Ziele sind die volle Einheit im Glaubensbekenntnis, im sakramentalen Leben und in der kirchlichen Gemeinschaft mit den Bischöfen in apostolischer Sukzession und eine "Heilung" der dem Leib Christi zugefügten Wunden. Ihm dient gewiss die Methode des "differenzierten Konsenses" und einer "Hermeneutik des gegenseitigen Vertrauens" (S. 154) mit der "Bereitschaft zu einer wohlwollenden Interpretation des anderen." (S. 126).
Dogmenhermeneutik
Die "aktive Rezeption" (S. 156) wird erleichtert durch die mehr organische Interpretation der einzelnen Dogmen im Gesamtgefüge des Glaubens -der analogia fidei. Dabei ist ein mögliches Missverständnis der Rede des II. Vatikanums von der Hierarchia veritatum (UR 11) zu vermeiden. Es geht dabei nicht um die mechanische Schichtung von "zentralen" und "nachrangigen Wahrheiten" (vgl. KuKg II 43; 53; 62), sondern um die Frage, ob eine von der Kirche verkündete Wahrheit in der Offenbarung enthalten ist oder nicht. Deshalb muss man unterscheiden zwischen der Bezeichnung eines (ohne persönliche Schuld nicht zur katholischen Kirche gehörenden) Christen als Häretiker und der bewussten Leugnung eines Dogmas als Häresie seitens eines Katholiken.
Die Dogmen bestimmen nicht, was einer glauben muss, sondern sie sind das Bekenntnis dessen, was die Kirche de fide divina et catholica glaubt. Wer also zur katholischen Kirche gehören will, kann nicht anders als jedes einzelne Dogma als eine Teilhabe an jener Wahrheit (und deren Ausstrahlung) anzusehen, in der sich Gott in Jesus Christus geoffenbart hat. Es bleibt dem einzelnen Katholiken nicht überlassen, ob er ein Dogma als geoffenbarte Heilswahrheit annimmt oder es im subjektiven Privaturteil für sich auf eine theologische Lehrmeinung zurückstuft. Etwas anderes ist die fides implicita. Zu Recht wird auf eine entwickelte "fundamentalhermeneutische Dogmenhermeneutik" (KuKg 60) als Methode der ökumenischen Annäherung im Verständnis der jeweils anderen Lehrtradition hingewiesen, die auch zugleich ein vertieftes Verständnis und verbesserte Darlegung des eigenen Glaubens im Licht von Zustimmung und Gegenrede ermöglicht.
Aber gerade der altkatholische und auch orthodoxe Widerstand gegen die Papst- und Mariendogmen kann nicht so einfach und evident mit einer mangelnden expliziten Schriftbegründung oder mit einer nicht eindeutigen Bezeugung durch die "alte Kirche", d.h. des 1. Jahrtausends der "ungeteilten Christenheit", begründet werden, wie es in der dortigen "Normaldogmatik" der Fall zu sein scheint.
Der unbezweifelbare Kenner der "alten Kirche", John Henry Newman (1801-1890), hat gerade wegen der Kirchenväter aufgrund seiner "Entwicklung der Glaubenslehre" (1845) den Weg von der anglikanischen Gemeinschaft in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche gefunden. Und es waren für ihn gerade (u.a.) die katholische Lehren vom Papsttum wie auch von der Marien- und Heiligenverehrung, die er ursprünglich als ungerechtfertigte "römische Neuerungen" abgelehnt hatte und weshalb er die katholische Kirche im Irrtum sah und die er von nun im Einklang mit den Prinzipien der Dogmenentwicklung in der katholischen Kirche als zu Recht dogmatisiert anerkannte.
Zur Ekklesiologie
Mit gutem Grund geht KuKg II von der Communio-Ekklesiologie aus, die zwar dem Wort nach nicht ausdrücklich in Lumen gentium vorkommt (außer in der Formulierung: corpus ecclesiarum, LG 23), aber der Sache nach die Kirchenkonstitution prägt, so dass die horizontale Communio der Gläubigen in der transzendentalen Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott und der Teilhabe am Christus-Geheimnis im Heiligen Geist begründet ist (LG 1-4). Allerdings ist die sichtbare, gesellschaftliche verfasste Kirche der sakramentale Ausdruck der gnadenhaften Gemeinschaft (der unsichtbaren Kirche) mit dem dreifaltigen Gott. Die Kirche spiegelt die Einheit der göttlichen Personen und vermittelt die Teilhabe an ihrer trinitarischen Gemeinschaft. Sie ist darum auch sichtbar nur die Eine Kirche Christi, die er selbst geschichtlich initiiert hat. Auf dieser Ebene kann nur von der Kirche in der Einzahl die Rede sein. Die eine Kirche ist aber auch gegenwärtig in den bischöflichen verfassten, örtlich umschriebenen Gemeinschaften, die man darum seit dem NT schon die Kirchen im Plural nennt, ohne dass man deswegen das Verhältnis der Kirche und ihrer Gegenwart in den Kirchen gegeneinander abwägen müsste. Diese örtlichen Kirchen als Repräsentanz der eine katholischen Kirche sind natürlich etwas ganz anders als die spätere Konfessionskirchen, die im Gegensatz stehen zur katholischen Kirche in Einheit mit dem Papst und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm. Der sich einbürgernde Sprachgebrauch von der universalen Kirche und den lokalen oder partikulären Kirchen darf aber nicht zu dem Missverständnis führen, dass das Ganze der Kirche aus den Einzelkirchen nachträglich zusammengesetzt sei und sich die Kirche (soziologisch gedacht) "von unten nach oben hin" aufbaut.
Den Primat des Nachfolgers Christi -und seinen Dienst an der Einheit im Glauben und der sakramentalen Gemeinschaft der Bischöfe und den ihrer Hirtensorge anvertrauten Gläubigen- kann man in seiner Existenz nicht begründen als eine Art Postulat, das sich aus der örtlichen regionalen, synodalen und universalen Gliederung der Kirche ergibt oder der aus pragmatischen Gründen zu akzeptieren sei. Der Primat des Papstes beruht nach dem katholischen Glauben auf der Einsetzung Petri durch Christus, dem Gründer Seiner Kirche (Mt 16,18), und der Übertragung des Hirtendienstes an Seinen Schafen und Lämmern (Joh 21, 15-17). Was das Zusammenwirken der Bischöfe mit dem Nachfolger Petri in Rom angeht, muss sowohl ein Papalismus wie ein Episkopalismus (als Bezeichnungen einer eliminatorischen Absorption eines wesentlichen Konstitutionsprinzips durch das andere) in Theorie und Praxis vermieden werden. Die (universale) Kirche wird geleitet durch den Episkopat, dessen Prinzip der Einheit der Bischof von Rom ist, während die (lokalen) Kirchen geleitet werden durch den Bischof als Nachfolger der Apostel in Gemeinschaft mit den anderen Bischöfen und besonders mit dem Bischof von Rom. (LG 23).
Natürlich kann man die verschiedenen Dimensionen der Kirche, die ein Mysterium ist (LG 1), nicht more geometrico in einer gänzlich siegelbildlichen Adaequation von res et intellectus erfassen und vereindeutigen.
Die Überlegungen von KuKg II können viele historisch bedingte Missverständnisse in der Dogmatik entschärfen und den Weg zu einer größeren Einheit im gemeinsamen Zeugnis des Glaubens weisen. Es muss aber der genannte hermeneutische Vorbehalt, dass das Glaubensgeheimnis niemals adäquat in der theologischen Reflexion und Sprache gleichsam "rationalisiert und verbalisiert" werden kann, beachtet werden. Diese Erkenntnis ist schließlich kein Stolperstein, sondern eher ein Wegweiser der ökumenischen Theologie.
Die Mariendogmen
Hier wird auf den Weg einer vertieften und wohlwollenden Prüfung verwiesen. Einerseits werden die Katholiken mit den Vorbehalten der andern Seite vertraut gemacht. Andererseits erschließen sich die Altkatholiken die positiven Intentionen der katholischen Aussage zur Empfängnis der Mutter Gottes ohne den Makel der Erbsünde wie auch zu ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel. Denn wie die Papstdogmen im Gesamtrahmen einer Communio-Ekklesiologie in ein anderes Licht tauchen, so sind auch die Mariendogmen von 1854 und 1950 im Kontext einer heilsgeschichtlichen Gesamtkomposition der Selbstmitteilung Gottes als Wahrheit und Leben des Menschen neu zu lesen. Die traditionelle Kontradiktion neigt sich in die Richtung eines wechselseitigen Verstehens und einer anfänglichen Komplementarität.
In diesem Licht könnten die Altkatholiken ihre strikte Ablehnung zurücknehmen, wenn im Gegenzug die katholische Kirche denen, die die Mariendogmen eher als begründete theologische Meinung verstehen, die Verurteilung als Häretiker erlassen würde.
Die katholischen Dialog-Teilnehmer sagen es so: " Wenn und insofern die wohlwollende Interpretation der Mariendogmen durch die Altkatholiken die wesentlichen theologischen Anliegen dieser Dogmen bewahrt, muss ein altkatholisches Marienverständnis aus römisch-katholischer Sicht nicht als häretisch verurteilt werden, wenngleich die Marienfrömmigkeit in beiden Kirchen einen unterschiedlichen Stellenwert hat." (KuKg II 61).
Man wird aber kritisch nachfragen dürfen, ob man die beiden Mariendogmen (zu) einfach nur der mittelalterlichen Volksfrömmigkeit und der spezifischen, (angeblich von den Päpsten volkspädagogisch und kirchenpolitisch geförderten) Marienfrömmigkeit des 19. Jahrhunderts zuordnen oder gar daraus ableiten kann. Denn darin geht es um die von Gott geoffenbarte Wahrheit, die zwar in ihrer theologischen Formulierung immer auch die geistesgeschichtlichen und kulturellen Spuren aus der Epoche ihrer definitiven Vorlage als Dogma an sich trägt -aber eben durch die Autorität Gottes verbürgt ist.
Das ist auch gegenüber den Interpretationskünsten mancher katholischer Theologen zu sagen, die meinen sich für die Papst- und Mariendogmen entschuldigen zu müssen, indem sie den "Ultramontanismus" für ihre eigene Verlegenheiten gegenüber der geoffenbarten Wahrheit verantwortlich machen (vgl. KuKi II 50).
Insofern ist es eine eindeutige Schwäche des Textes, dass man die Wahrheit des christlichen Dogmas überhaupt nicht in der Autorität des sich offenbarenden Gottes begründet sieht, sondern das angeblich im 19. Jahrhundert noch verbreitete Autoritätsdenken der "unaufgeklärten" Massen für die Rezeption der Papst- und Mariendogmen im katholischen Volk verantwortlich macht, über das die "modernen" Christen hinausgewachsen seien. In Abweichung vom kirchlichen Sprachgebrauch, in dem "hierarchisch" ein Synonym für "sakramental" ist, d.h. dem Mysterium entspringend, (vgl. LG 18- 29: "Die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt"), wird im Dialog-Text der Begriff "hierarchisch" (Ps-Dionysius Areopagita, De ecclesiastica hierarchia) mit "autoritär" gleichgesetzt und dann pejorativ als Aberkennung der Mündigkeit der Laien und als bürgerliche Subordination eingeführt (vgl. KuKg 32).
Insgesamt aber ist es sehr erfreulich, dass die altkatholische Seite den inneren Sinn der beiden Mariendogmen von 1854 und 1950 im Kontext einer heilsgeschichtlich (und nicht bei individuellen Privilegien) ansetzenden Mariologie positiv rezipieren kann. (vgl. KuKi II 59).
Dass die "alte Kirche" gar nichts in Richtung des Verhältnisses von Maria und Erbsünde geahnt hätte, wird man wohl auch historisch widerlegen können. Die Frage ging bis in 11. Jahrhundert und darüber hinaus eher um den Zeitpunkt, an dem Maria von der Erbsünde befreit wurde. Wenn die Kirchenväter Maria als die neue Eva neben ihrem Sohn, dem neuen Adam, bezeichnen, dann kann nur die "Eva im Urstand" vor der Ur- und Erbsünde gemeint sein (u.a. Irenäus von Lyon, Adv. Haereses V, 19, 1). Nach dem dogmatischen Glauben ist auch Maria durch die Erlösungsgnade Christi von der Erbsünde befreit worden im Sinne der Bewahrung vor ihr schon im ersten Augenblick ihrer Empfängnis im Schoß ihrer Mutter. Das ist jedenfalls logischer, als dass sie kurz vor der (für die ganze Menschheit entscheidenden Einwilligung) in die Annahme des Menschseins durch den Sohn Gottes aus ihr von der Erbsünde erlöst worden wäre. Denn hier geht es um die realen Konditionen und nicht um die Chronologie der Heilsgeschichte. Die Auferstehung Abrahams, Isaaks und Jakobs ist schon antizipiert durch den Gott der Lebenden (Lk 20, 38), obwohl Christus der Erste ist der Entschlafenen ist, durch den alle an der Auferstehung teilhaben (1 Kor 15, 20). Hier muss der sachliche Grund des Heils in Gott, die Erwählung, von der Chronologie des Heilsvermittlung in der geschichtlichen Abfolge der Heilsereignisse unterschieden werden.
Zur sakramentalen Weihe von Frauen im dreistufigen Amt
Im dritten Teil von KuKi II Nr. 65- 80 folgen rein altkatholische Überlegungen zur Praxis der sakramentalen Weihe von Frauen in ihrer eigenen Gemeinschaft. Die katholischen Partner nehmen eigenartigerweise keine inhaltliche Stellung dazu und verweisen nur passiv auf die Position in KuKi I (Nr. 57-62; 81-82).
Es fällt der Widerspruch auf, dass man einerseits die Papst- und Mariendogmen des 19. Jahrhunderts sehr stark aus der Volksfrömmigkeit und einer engen ultramontanistischen Geisteshaltung, also aus un-theologischen Motivlagen, erklärt, andererseits aber die Möglichkeit zur Priesterweihe der Frau aus dem sensus fidelium ableitet und mit dem Hinweis auf die historische Diskriminierung der Frau die klassischen theologischen Argumente gegen diese Möglichkeit vom Tisch fegt (KuKi II 75-80).
Gemäß der Hermeneutik der katholischen Theologie hat das Lehramt nicht nur die von Gott gegebene Vollmacht, inhaltliche Fragen zu entscheiden, sondern auch im Vorfeld zu erkennen, ob es sich um eine die Offenbarung selbst betreffende Problemstellung handelt oder nur um gesellschaftlich bedingte Begleiterscheinungen. Insofern kann die katholische Kirche nicht hinter die Entscheidungen von Papst Johannes Paul II. in "Ordinatio sacerdotalis" (1994) zurück, dass hier "die göttliche Verfassung der Kirche" betroffen ist und "dass die Kirche in keiner Weise die Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und dass diese Sentenz von allen Gläubigen definitiv festzuhalten ist..." (DH 4983). Andernfalls würde sie das dogmatische Fundament ihres Glaubens in der Offenbarung erschüttern und ihre Lehre den Opportunitäten des Populismus überlassen. Hier ist an Newmans Unterscheidung des dogmatischen Glauben der Kirche und der liberalen Auslegung des Christentums als eine Summe von Symbolen und Riten, die nur der frommen Subjektivität des Gläubigen schmeicheln (vgl. seine berühmte Biglietto-Rede bei seiner Erhebung zum Kardinal 1879).
Der sensus fidelium bildet sich an der Offenbarung, die im Glaubens-Bewusstsein aller Glieder des Leibes Christi durch das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes gegenwärtig ist, ist aber nicht das Einfallstor des Zeitgeistes in die Kirche (LG 12).
KuKi II leidet in dieser Hinsicht am Manko einer fundierten katholischen Antwort auf diese Frage, die eine volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche unmöglich macht.
Gesamtbewertung
Trotz dieses schwerwiegenden Versäumnisses ist KuKi II (2016) im Hinblick auf die Stellung des Papstes in der Kirche und die beiden letzten Mariendogmen ein wichtiger Teilerfolg zuzuerkennen und als Schritt hin zu der von Christus gewollten Einheit aller Jünger in Seiner Kirche mit vollziehbar.