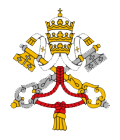Symposium „Jesus der Christus im Glauben der einen Kirche.
Christologie – Kirchen des Ostens – Ökumenische Dialoge“
an der Philosophisch−Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt
21. September 2017
Jesus der Christus: Grund der Einheit Oder Motiv der Trennung?
Das, was uns Christen eint, ist viel grösser als das, was uns noch trennt; und glücklicherweise konnte bei den Kirchenspaltungen in der Geschichte der Bruch nicht bis in die Mitte des Glaubens vordringen und sie zerstören. Diese beiden Urteile sind in der heutigen ökumenischen Diskussion Allgemeingut geworden und geben einen breiten ökumenischen Konsens wieder. Ihm scheint freilich der Titel des Vortrags zu widersprechen, wenn er das Motiv der Trennung auch im Glauben an Jesus Christus ausfindig macht - zumindest als Frage. Wie aber soll denn der Glaube an Jesus Christus Grund der Trennung sein können, wenn uns mehr eint als trennt und wenn die Spaltungen nicht bis in die Mitte des Glaubens vordringen konnten? Denn welche andere Mitte als das Bekenntnis zu Jesus Christus könnte es denn im christlichen Glauben geben? Heute ist deshalb evident geworden, dass der Glaube an Jesus Christus nicht trennt, sondern eint. In der Geschichte der Kirche hingegen ist der Glaube an Jesus Christus nicht nur Grund der Einheit, sondern auch Motiv der Trennung gewesen. Diesem schwer wiegenden Sachverhalt müssen wir uns zuwenden, um durch die Wahrnehmung der Überwindung dieses elementaren Ärgernisses erst recht die Einheit unter uns Christen im Glauben an Jesus Christus wiederzufinden, der selbst am Abend vor seinem Leiden gebetet hat, dass die Jünger eins sein sollen, damit die Welt glauben kann, dass er der von Gott in die Welt Gesandte ist.
1. Das Christusbekenntnis im Dialog mit den Kirchen des Ostens
Jesus Christus ist „der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person und einer Hypostase vereinigt“. Mit diesen Worten hat das Vierte Ökumenische Konzil von Chalkedon im Jahre 451 nach einem langen und intensiven, kontroversen und harten Ringen in der frühen Kirche das einmalige und einzigartige Geheimnis Jesu Christi umschrieben, und zwar mit dem Ziel, die grundlegende Glaubensüberzeugung festhalten zu können, dass Jesus Christus derselbe ist „vollkommen in der Gottheit“ und derselbe ist „vollkommen in der Menschheit“, derselbe ist „wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch aus vernunftbegabter Seele und Leib“, und derselbe ist „der Gottheit nach dem Vater wesensgleich und der Menschheit nach uns wesensgleich, in allem uns gleich ausser der Sünde“[1]. Über diesen Konzilsentscheid hat Papst Benedikt XVI. bereits in den siebziger Jahren geurteilt, das Konzil von Chalkedon sei für ihn „die grossartigste und kühnste Vereinfachung des komplizierten, äusserst vielschichtigen Traditionsbefunds auf eine einzige, alles andere tragende Mitte hin: Sohn Gottes, gleichen Wesens mit Gott und gleichen Wesens mit uns“. Und Joseph Ratzinger hat hinzugefügt, im Gegensatz zu vielen anderen Möglichkeiten, die im Laufe der Geschichte versucht worden sind, habe Chalkedon Jesus „theo-logisch ausgelegt“, und dies sei „die einzige Auslegung, die der ganzen Breite der Überlieferung gerecht zu werden“ vermöge und „die volle Wucht des Phänomens aufnehmen“ könne, und hier eröffne sich „das Ganze“ im Unterschied zu allen anderen Auslegungen, die „irgendwie zu schmal sind“, weil jeder andere Begriff nur einen Teil erfasse und einen anderen ausschliesse.[2]
a) Christologische Streitigkeiten nach dem Konzil von Chalkedon
Führt man sich die christologische Lehrentscheidung des Konzils von Chalkedon und das beinahe hymnische Lob des damaligen Theologen Joseph Ratzinger über dieses Konzil vor Augen, kann man nur äusserst erstaunt das geschichtliche Faktum zur Kenntnis nehmen, dass diese Lehrentscheidung Ursache und Grund der ersten grossen Kirchenspaltungen im fünften Jahrhundert gewesen ist, die bis heute noch nicht ganz überwunden sind. Diejenigen Kirchen, die das Konzil nicht angenommen haben, werden als Orientalisch-Orthodoxe Kirchen bezeichnet, zu denen die Koptisch-Orthodoxe Kirche, die Syrisch-Orthodoxe Kirche, die Armenisch-Apostolische Kirche, die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, die Eritreisch-Orthodoxe Kirche und die Malankara Orthodox-Syrische Kirche gehören.[3] Diese Kirchen sind heute wegen ihrer weiteren Verbreitung auch in der westlichen Welt und vor allem wegen der konfliktuösen Entwicklungen in der arabischen Welt vermehrt im öffentlichen Bewusstsein präsent. Weil sie das Konzil von Chalkedon, das Vierte Ökumenische Konzil nicht akzeptiert haben, werden sie auch die Kirchen der ersten drei Ökumenischen Konzilien genannt. In einer besonderen geschichtlichen Situation befindet sich die Assyrische Kirche des Ostens, auch als Ostsyrische Kirche bezeichnet, die nur das Konzil von Nicaea im Jahre 325 und das Konzil von Konstantinopel im Jahre 381, nicht aber das Konzil von Ephesus im Jahre 431 rezipiert hat. Weil die christologische Lehrentscheidung des Konzils von Chalkedon der Grund der Trennungen gewesen ist, unterscheidet man zwischen den chalkedonischen Kirchen, zu denen die Orthodoxen Kirchen, die Katholische Kirche und die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen gehören, und den nicht-chalkedonischen Kirchen.
In der damaligen Zeit ist es nicht einfach gewesen, kirchliche Glaubensverantwortung und Reichspolitik voneinander zu unterscheiden oder gar zu trennen, weshalb bei den Kirchenspaltungen im fünften Jahrhundert gewiss auch politische Motive eine nicht nur unbedeutende Rolle gespielt haben. Der theologische Grund für die Spaltungen ist aber der Streit um eine adäquate und vor allem rechtgläubige Formulierung des Christusbekenntnisses gewesen. Um besser verstehen zu können, worum es sich bei diesem Streit gehandelt hat, legt es sich nahe, sich zunächst vor Augen zu führen, was beiden Seiten in diesem Streit gemeinsam gewesen ist. Dies ist das Christusbekenntnis, das von den Konzilien von Nicaea und Konstantinopel bezeugt worden ist: Wir glauben an „(den) einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt, das heisst aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf der Erde ist, der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgestiegen und Fleisch und Mensch geworden ist“[4]. Da auf der einen Seite Jesus Christus als „wesensgleich mit dem Vater“ prädiziert wird, handelt es sich dabei um ein eindeutiges Bekenntnis zum Gott-Sein Jesu Christi. Und da auf der anderen Seite von Christus ausgesagt wird, dass er Fleisch und Mensch geworden ist, wird auch ein eindeutiges Bekenntnis zum Mensch-Sein Jesu Christi abgelegt.
Die Frage, die sich von daher dem Glaubensbewusstsein aufdrängte, war diejenige, wie denn der Sohn Gottes, der ganz Gott ist, überhaupt Mensch werden kann, ohne dass er aufhören müsste, Gott zu sein, wie sich also in Jesus Christus das Gott-Sein und das Mensch-Sein miteinander verhalten und wie dieses Verhältnis in theologischer Begrifflichkeit adäquat zum Ausdruck gebracht werden kann. Wie wir gesehen haben, antwortete das Konzil von Chalkedon, das die Glaubensbekenntnisse von Nicaea und Konstantinopel selbstverständlich voraussetzt, mit der Aussage, dass Christus eine Person in zwei Naturen ist, die als „unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar“ erkannt werden. Da entschieden hervorgehoben wird, dass der Unterschied der Naturen wegen der Einung niemals aufgehoben ist, die Eigentümlichkeit von jeder der beiden Naturen vielmehr bewahrt ist, wird diese christologische Lehrentscheidung von Chalkedon als „Zwei-Naturen-Lehre“ oder mit dem Fachterminus als „Dyophysitismus“ bezeichnet.
Diejenigen Kirchen, die diese christologische Formel nicht annehmen konnten, sondern der vor allem in Alexandrien lebendigen Glaubensüberlieferung, dass die eine göttliche Natur in Jesus von Nazareth Fleisch geworden ist, treu bleiben wollten, verstanden die chalkedonische Aussage „in zwei Naturen“ dahingehend, das Konzil würde von zwei Subjekten reden und damit eine Zwei-Söhne-Lehre vertreten. Um eine solche Häresie zu überwinden, betonten sie deshalb, dass in Christus nicht zwei Naturen, sondern eine Natur gegeben ist. Aus diesem Grunde wurden die Gegner des Konzils als „Monophysiten“ bezeichnet, was allerdings ihrer christologischen Überzeugung nicht angemessen ist, da sie keine Mono-Natur vertraten, sondern von der einen Natur in Christus aussagten, dass sie nicht „in zwei“, sondern „aus zwei“ besteht. Indem sie ihre Glaubensüberzeugung mit der Mia-Physis-Formel zum Ausdruck brachten, ist es adäquater, ihre Position als „Miaphysitismus“ zu bezeichnen.
Einen nochmals anderen Weg ist die Assyrische Kirche des Ostens gegangen, die, wie gesagt, bereits das Konzil von Ephesus im Jahre 431 nicht angenommen und damit auch die auf diesem Konzil ausgesprochene Verurteilung des Nestorius als ungerecht betrachtet hat. Sie ist deshalb in der Geschichte in polemischer Absicht als „nestorianische Kirche“ charakterisiert worden. Da sie in ihrer Theologie weithin dem bedeutenden Exegeten und Theologen Theodor von Mopsuestia im fünften Jahrhundert gefolgt ist, ist sie adäquater als „Theodorianische Kirche“ zu bezeichnen. Sie hat sich nicht gegen die Aussage von zwei Naturen in Christus gewandt, sondern gegen die von einer Hypostase, mit deren Annahme man die reine Lehre verlassen habe. Demgemäss gibt es in der Sicht der Assyrischen Kirche in Christus zwei Naturen mit ihren hypostases (gnome) und ein prosopon der Sohnschaft.
Auf nicht wenige Christen heute dürften diese christologischen Auseinandersetzungen im fünften Jahrhundert den Eindruck von theoretischen Streitereien oder, wie es heute gerne heisst, von akademischen Spitzfindigkeiten machen. Die äusserst starke und teilweise erbitterte Polemik, mit der diese christologischen Auseinandersetzungen damals geführt worden sind, weisen allerdings nicht einfach nur auf theologische oder bischöfliche Streitlust hin, sondern auf ein viel tiefer liegendes Motiv. Für beide Seiten handelte es sich vor allem um eine soteriologische Frage, bei deren Beantwortung das Heil der Menschen auf dem Spiel steht. Da die Menschen in der damaligen Zeit sehr stark unter der Erfahrung der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit litten, richtete sich ihre entscheidende Existenzfrage darauf, wie das endliche Seiende am unendlichen Sein so Anteil gewinnen kann, dass es gegen die Vergänglichkeit alles Irdischen und gegen das eigene Vergehen im Tod Bestand im ewigen Sein Gottes gewinnen kann. Von daher war es für die damaligen Menschen evident, dass ein blosser Mensch die Menschen nicht erlösen kann, weil dies nur Gott vermag. Auf der anderen Seite war ebenso klar, dass der transzendente Gott sich nicht einfach mit etwas Geschöpflichem verbinden kann. Von daher stellten sich die bedrängenden Fragen, wie es zu einer Einheit von Gottheit und Menschheit überhaupt kommen kann und ob in Christus eine oder zwei Naturen existieren. Und noch prinzipieller ergaben sich die Fragen, was unter Natur und was unter hypostasis, prosopon und persona zu verstehen ist. Über diese Fragen wurden heftige Auseinandersetzungen geführt, die die Spaltung zwischen den chalkedonischen und den nicht-chalkedonischen Kirchen provoziert haben, die sich im Laufe der Geschichte immer mehr voneinander entfremdet haben.
b) Christologische Konsenserklärungen in den ökumenischen Dialogen
Zu einer Wiederannäherung zwischen diesen Kirchen ist es erst im ökumenischen Zeitalter gekommen. Weil es bei den Kirchenspaltungen im fünften Jahrhundert um das Christusbekenntnis und damit um die innerste Mitte des christlichen Glaubens ging, versteht es sich leicht, dass bei den beginnenden ökumenischen Gesprächen mit den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen in erster Linie christologische Fragen zu behandeln gewesen sind. Ein wichtiger Anstoss ist dabei von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt ausgegangen, an der der spätere Kardinal Alois Grillmeier als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte gewirkt hat.[5] Er nahm das 1500-jährige Jubiläum des Konzils von Chalkedon im Jahre 1951 zum Anlass, es mit einer Festschrift zu würdigen. Aus diesem Projekt ist das wissenschaftliche Werk „Das Konzil von Chalkedon“ entstanden, das er zusammen mit Pater Heinrich Bacht in drei Bänden herausgegeben hat, das sich durch eine grosse ökumenische Offenheit für andere christliche Kirchen auszeichnet und in dem Studien über die Christologie auch in nicht-chalkedonischen Kirchen enthalten sind. Diese Forschungsarbeit mit ökumenischer Sinnrichtung hat Pater Grillmeier auch in seinem grossen christologischen Werk „Jesus der Christus im Glauben der Kirche“ weitergeführt und dabei als erfreuliches Ergebnis formulieren können, „dass bei allen Verschiedenheiten mit ihren kulturellen und geistigen Vorbedingungen die grossen Gebiete des Orbis christologicus, sive orientalis, sive occidentalis, in der Substanz des Christusglaubens eins sind, dies vor allem vom Taufkerygma und vom Alltagsglauben der Kirchen her“. Dabei legte Grillmeier Wert darauf, dass er den Nachweis der Gemeinsamkeit unter den christlichen Kirchen „nicht in erster Linie auf dem Gebiet der théologie savante oder auf der Ebene der spekulativen Christologie“ legen wollte, „sondern vielmehr auf der Gemeinsamkeit des Glaubens und der Verkündigung“[6].
Eine wichtige Fortsetzung und Vertiefung dieses erfreulichen Ergebnisses ist von der von Kardinal Franz König in Wien gegründeten Stiftung Pro Oriente ermöglicht worden, mit der er das Ziel verfolgte, auf inoffizieller Ebene Gespräche in Bewegung zu bringen, die auf der offiziellen Ebene noch nicht geführt werden konnten, und zwar in der Überzeugung, dass es, wie er selbst sagte, nicht „möglich gewesen wäre, eine ähnliche freundliche Atmosphäre im Vatikan für die ersten Gespräche seit Jahrhunderten mit unseren Schwesterkirchen im Osten zu schaffen. Die Ängste und Feindseligkeiten, die sich über die Jahrhunderte gesammelt hatten, wären ein zu grosses Hindernis gewesen“[7]. Mit diesem grossen Dienst des ökumenischen Brückenbaus in der Christenheit zwischen Ost und West hat Pro Oriente auch den ökumenischen Dialog mit dem Orientalischen Christentum intensiv gepflegt und gefördert.[8] Dies gilt bereits von der ersten Pro-Oriente-Konsultation, die im Jahre 1971 in Wien mit Vertretern der Orientalisch-Orthodoxen Kirchen stattgefunden und sich die Aufgabe vorgenommen hat, den grossen Konflikt um das Konzil von Chalkedon zu analysieren und damit die belastende Vergangenheit aufzuarbeiten. Diese Konsultation endete mit dem erfreulichen Ergebnis einer weitgehenden Übereinstimmung im Christusglauben, die mit der so genannten „Wiener christologischen Formel“ zum Ausdruck gebracht wurde. In dieser Formel wird die Einheit von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus deutlich hervorgehoben und zugleich deren Unterschiedenheit ebenso deutlich festgehalten, ohne dabei die umstrittenen Fachtermini wie physis, hypostasis und prosopon zu verwenden. Damit ist sichtbar geworden, dass es sich bei den christologischen Streitigkeiten im fünften Jahrhundert wesentlich auch um ein Sprachproblem gehandelt hat, insofern man von verschiedenen philosophischen Begriffen wie „Natur“ und „Person“ ausgegangen ist, im Grunde jedoch denselben Christusglauben bezeugen wollte.[9]
Diese wichtigen ökumenischen Vorarbeiten haben die späteren offiziellen Dialoge und die auf sie folgenden christologischen Erklärungen zwischen dem Bischof von Rom und Oberhäuptern von verschiedenen Orientalisch-Orthodoxen Kirchen vorbereitet, zunächst mit der Syrisch-Orthodoxen Kirche. Bereits im Oktober 1971 kam es in Rom zu einer Begegnung zwischen Papst Paul VI. und dem Syrischen Patriarchen von Antiochien Mar Ignatius Yaqub III. Beide Kirchenoberhäupter stellten dabei in ihrer gemeinsamen Erklärung fest, „dass im Glauben an das Mysterium des Wortes Gottes, das Fleisch und wahrhaft Mensch geworden ist, kein Unterschied besteht, auch wenn über Jahrhunderte hin Schwierigkeiten auf Grund verschiedener theologischer Ausdruckweise im Bekenntnis des Glaubens entstanden sind“[10]. Diese Übereinstimmung im Christusbekenntnis wurde nochmals bestätigt beim Besuch des Syrisch-Orthodoxen Patriarchen von Antiochien und des Ganzen Ostens, Ignatius Zakka I. Iwas, bei Papst Johannes Paul II. in Rom im Juni 1984. In ihrer gemeinsamen Erklärung hoben beide Kirchenführer hervor, „dass die Verwirrungen und die Schismen, die zwischen ihren beiden Kirchen in den späteren Jahrhunderten auftraten, in keiner Weise die Substanz ihres Glaubens betrafen oder berührten; denn diese entstanden nur durch die Unterschiede in der Terminologie, in der Kultur und durch die verschiedenen Formeln, die von den unterschiedlichen theologischen Schulen formuliert wurden, um denselben Inhalt zum Ausdruck zu bringen“. Auf Grund dieser Erkenntnis gebe es heute „keine reale Grundlage mehr für die traurigen Trennungen und Schismen, die als deren Folgen zwischen uns entstanden betreffend der Lehre der Inkarnation“: „In Worten und Leben bekennen wir die wahre Lehre bezüglich Christus, unserem Herrn, ungeachtet der Unterschiede in der Interpretation solcher Lehren, wie sie zur Zeit des Konzils von Chalkedon aufkamen.“[11] Mit dieser Erklärung wurden 1500 Jahre nach dem Konzil von Chalkedon die christologischen Differenzen zwischen der Syrisch-Orthodoxen Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche in einer offiziellen Weise bereinigt. Auf dieser Gemeinsamen Erklärung aufbauend haben beide Kirchenführer ein pastorales Abkommen mit der Ermöglichung des wechselseitigen Empfangs der Sakramente der Busse, der Eucharistie und der Krankensalbung in Notfällen unterzeichnet.[12] Über dieses pastorale Abkommen hat Theresia Hainthaler mit Recht geurteilt: „Bis heute ist es das erste Mal in der Geschichte der Ökumene, dass die katholische Kirche und eine andere Kirche eine solche Möglichkeit akzeptiert und autorisiert haben.“[13] Dass trotz weiter bestehender Kirchentrennung eine begrenzte communicatio in sacris ermöglicht worden ist, verdient in der Tat das Attribut „historisch“.
Gemeinsame Erklärungen über die christologischen Differenzen und deren Überwindung hat der jeweilige Bischof von Rom auch mit anderen Kirchenführern vereinbart. Zu erinnern ist vor allem an die Gemeinsame Erklärung zwischen Papst Paul VI. und dem Koptisch-Orthodoxen Patriarchen Shenuda III. am 10. Mai 1971 in Rom. In dieser Erklärung, mit der der offizielle koptisch-katholische Dialog begründet worden ist, wird im Blick auf das Christusbekenntnis festgehalten, dass „Jesus Christus, vollkommener Gott in Bezug auf seine Gottheit und vollkommener Mensch in Bezug auf seine Menschheit ist. In ihm ist seine Gottheit verbunden mit seiner Menschheit in einer wirklichen vollkommenen Einheit ohne Vermischung, ohne Vermengung, ohne Verschmelzung, ohne Veränderung, ohne Teilung, ohne Trennung. Seine Gottheit hat sich nie von seiner Menschheit getrennt, nicht einmal einen Augenblick, nicht einen Atemzug lang. Er, der ewige und unsichtbare Gott, wurde sichtbar im Fleisch und nahm Knechtsgestalt an. In ihm sind alle Eigenschaften der Gottheit und alle Eigenschaften der Menschheit zugleich in einer wirklichen, vollkommenen, unteilbaren und untrennbaren Einheit bewahrt.“[14] Für den heute amtierenden Papst-Patriarchen Tawadros II. ist dieses Ereignis von so grundlegender Bedeutung, dass er anlässlich des 40. Jahrestags der Unterzeichnung dieser Erklärung Papst Franziskus in Rom besuchte und anregte, den 10. Mai in beiden Kirchen als Gedenktag und Tag der Freundschaft zu feiern.
Anlässlich des Besuchs des Obersten Patriarchen und Katholikos aller Armenier, Karekin I. bei Papst Johannes Paul II. in Rom am 13. Dezember 1996 haben beide Kirchenführer in ihrer Gemeinsamen Erklärung festgehalten, dass in der Geschichte „sprachliche, kulturelle und politische Faktoren“ ungeheuer viel zu den „theologischen Meinungsverschiedenheiten“ beigetragen haben, „die in der Terminologie, in der die betreffenden Lehrsätze formuliert wurden, zum Ausdruck kamen“, dass beide Kirchen heute aber den Glauben an Jesus Christus gemeinsam bekennen: „Vollkommen in seiner Gottheit, vollkommen in seiner Menschheit, ist seine Gottheit mit seiner Menschheit vereint in der Person des einziggeborenen Sohnes Gottes in einer Verbindung, die real, vollkommen, unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar ist.“[15] Eine ähnliche Gemeinsame Erklärung hat Papst Johannes Paul II. auch mit dem Katholikos Aram I. von Kilikien bei seinem Besuch in Rom am 25. Januar 1997 abgegeben.[16]
Man darf dankbar anerkennen, dass es eine ganze Reihe von bilateralen christologischen Erklärungen zwischen der Katholischen Kirche und verschiedenen Orientalisch-Orthodoxen Kirchen gibt. Zugleich gilt es festzuhalten, dass es bisher aber noch keine christologische Erklärung gibt, die für die gesamte Orientalisch-Orthodoxe Kirchenfamilie gelten könnte, und dass die christologische Frage auch noch nicht auf der Traktandenliste der Gemischten Internationalen Kommission für den theologischen Dialog zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen zu finden ist, die im Jahre 2003 ihre Arbeit aufgenommen und bisher zwei Dokumente vorgelegt hat, nämlich zuerst über „Wesen, Verfassung und Sendung der Kirche“ und anschliessend über Communio und Communicatio der Kirchen in den ersten fünf Jahrhunderten. Gegenwärtig befindet sich die Kommission in der dritten Phase und beschäftigt sich mit Fragen der Sakramentenlehre. Es versteht sich aber von selbst, dass die christologische Frage auch noch mit der ganzen Kirchenfamilie zu besprechen sein wird, um auf dem Weg zur eucharistischen Gemeinschaft einen wesentlichen Schritt weiter zu kommen.
c) Einheit im Glauben und Unterschied in der Terminologie
Es wären noch viele weitere ökumenische Dialoge über die christologische Frage zu erwähnen, nämlich zunächst die Dialoge zwischen der Orthodoxie, die auf dem Boden und in der Tradition von Chalkedon steht, und den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen. Diese Dialoge haben bereits in den sechziger Jahren in einer inoffiziellen Weise begonnen und sind seit 1985 in einen offiziellen Dialog überführt worden. Zu nennen sind ferner die Dialoge der Orientalisch-Orthodoxen Kirchen mit dem Reformierten Weltbund und mit den Anglikanern. Auf sie einzugehen ist hier freilich nicht der Ort[17]. Auf zwei Sachverhalte soll aber noch eigens hingewiesen werden.
Erstens fällt auf, dass in verschiedenen Dialogen über die christologische Frage die ökumenische Methode des so genannten differenzierenden Konsenses angewandt worden ist und sich als fruchtbar erwiesen hat. Mit dieser Methode wird formuliert, was als gemeinsam erkannt worden ist, und werden zugleich die verbleibenden Unterschiede benannt, die aber kein kirchentrennendes Gewicht mehr haben. Diese Methode zeigt sich vor allem in der Erklärung über die Christologie der Gemeinsamen Kommission der Katholischen Kirche und der Koptisch-Orthodoxen Kirche vom August 1976. In dieser Erklärung wird sowohl die Formel von den zwei Naturen, die im Konzil von Chalkedon verwendet worden ist, als auch die Mia-Physis-Formel der damaligen Gegner des Konzils von Chalkedon als gültig beurteilt. Zugleich werden die beiden Formeln durchsichtig gemacht für die Anliegen, die mit ihnen zum Ausdruck gebracht worden sind, und es wird erklärt, was mit der jeweiligen Begrifflichkeit auf katholischer und koptischer Seite gemeint gewesen ist[18]. Ein analoges Vorgehen findet sich auch in der Erklärung der Gemeinsamen Kommission der Römisch-Katholischen Kirche und der Malankarischen Syrisch-Orthodoxen Kirche vom Juni 1990. In ihr wird festgestellt, dass der Inhalt des Glaubens in beiden Kirchengemeinschaften derselbe ist, dass aber in der Formulierung dieses Inhalts im Laufe der Geschichte Unterschiede in Terminologie und Akzentsetzung aufgetreten sind. Beide Kirchengemeinschaften sind freilich der Überzeugung, „dass diese Unterschiede dergestalt sind, dass sie in derselben Gemeinschaft zusammen bestehen können und uns daher nicht zu trennen brauchen und trennen sollten“[19]. Die genannte ökumenische Methode ist auch in anderen ökumenischen Zusammenhängen, vor allem in der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen dem Lutherischen Weltbund und dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, angewandt worden und hat sich auch hier als fruchtbar erwiesen.
Zweitens sei eigens auf die Gemeinsame christologische Erklärung der Katholischen Kirche und der Assyrischen Kirche des Ostens hingewiesen, die nicht als der Orientalisch-Orthodoxen Kirchengemeinschaft zugehörig betrachtet wird. In der gemeinsamen Erklärung, die von Papst Johannes Paul II. und Mar Dinkha, dem Katholikos und Patriarchen der Assyrischen Kirche des Ostens in Rom am 11. November 1994 unterzeichnet worden ist, werden die Streitigkeiten in der Vergangenheit, die zu Anathematismen geführt haben, bedauert, es wird eingestanden, dass die so entstandenen Spaltungen „grösstenteils auf Missverständnisse zurückzuführen waren“, und es wird festgestellt, „dass wir uns heute geeint“ wissen „im Bekenntnis des gleichen Glaubens an den Sohn Gottes, der Mensch wurde, damit wir durch seine Gnade Kinder Gottes werden konnten“. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass sowohl die Vorstellung von zwei Subjekten in Christus als auch eine Adoptionschristologie abgelehnt wird: „Christus ist daher kein <gewöhnlicher Mensch>, den Gott adoptiert hat, um in ihm zu wohnen und ihn zu inspirieren, wie er es in den Gerechten und Propheten getan hat. Doch das gleiche göttliche Wort, von seinem Vater gezeugt vor aller Zeit ohne Anfang in Bezug auf seine Gottheit, wurde in der Endzeit in Bezug auf seine Menschheit von einer Mutter ohne einen Vater geboren. Die menschliche Natur, die die Jungfrau Maria geboren hat, war immer die des Sohnes Gottes selbst.“[20] Die Erklärung geht schliesslich auch auf die Bedeutung der gemeinsamen Christologie für die Ekklesiologie und die Lehre der Sakramente ein, weshalb im Anschluss an diese christologische Erklärung im offiziellen Dialog zwischen der Katholischen Kirche und der Assyrischen Kirche des Ostens ein gemeinsames Dokument über die Sakramente erarbeitet worden ist, das mit dem Titel „Comon statement on <sacramental life>“ im November 2017 unterzeichnet werden konnte.
d) Vertiefung des Christusglaubens und bleibende Aktualität
Im Rückblick auf die Vielfalt der gemeinsamen christologischen Erklärungen drängt sich eine zweifache Feststellung auf. Die erste ist eine traurige. Sie beinhaltet das Urteil, dass ein wesentlicher Grund der grossen christologischen Streitigkeiten und der anschliessenden Kirchentrennungen im fünften Jahrhundert ein Konzil gewesen ist, nämlich das Konzil von Chalkedon. Dabei handelt es sich um eine Einsicht, die man in der ganzen Kirchengeschichte verfolgen kann, dass nämlich die Zeiten, die auf ein Konzil folgten, beinahe immer schwierige Zeiten gewesen sind, weil die Konzilien oft zunächst Erschütterungen des kirchlichen Gleichgewichts ausgelöst haben und zu Faktoren einer tiefen Krise geworden sind. Davon legt ein beredtes Zeugnis vor allem die Antwort ab, die im vierten Jahrhundert Gregor von Nazianz, immerhin zusammen mit Basilius von Caesarea und Johannes Chrysostomos einer der drei heiligen Hierarchen, gegeben hat, als er vom Kaiser eingeladen und gebeten wurde, am Ersten Konzil von Konstantinopel teilzunehmen. In Erinnerung an das Konzil von Nizaea im Jahre 325 und vor allem an die Zeit nach dem Konzil, die weithin einem grossen Chaos glich, antwortete Gregor von Nazianz: „Um die Wahrheit zu sagen, so halte ich dafür, dass man jedes Konzil der Bischöfe fliehen sollte, da ich einen glücklichen Ausgang noch bei keinem Konzil erlebte…“[21] Es ist in der Tat paradox, dass Konzilien, die zur Selbstvergewisserung des Glaubens oder zu seiner Verteidigung angesichts von verbreiteten Häresien und insofern zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit einberufen werden, offensichtlich immer auch spalterische Keime in sich tragen, die sich dann nach dem Konzil auswirken. Die ersten grossen Kirchenspaltungen im fünften Jahrhundert sind dafür ein deutlicher Beleg.
Dies ist freilich nur die eine Seite. Auf der anderen Seite darf man mit Joseph Ratzinger ebenso klar festhalten, dass die grossen Konzilien des vierten und fünften Jahrhunderts, vor allem das Konzil von Chalkedon, in der Geschichte „Leichttürme der Kirche“ geworden sind, „die den Weg in die Mitte der Heiligen Schrift weisen und, indem sie ihre Auslegung prägen, zugleich die Identität des Glaubens im Wandel der Zeit klären“[22]. Diese positive Sicht hat sich in der Weiterentwicklung des christologischen Glaubens vor allem beim Dritten Konzil von Konstantinopel im Jahre 680/81 gezeigt, in dessen Licht auch die christologische Formel von Chalkedon in neuer Weise verstanden werden konnte. Denn der dieser Formel inhärente Parallelismus der beiden Naturen in Christus konnte im Sinne einer naturalistischen Verschmelzung der beiden Wesenheiten oder im Sinne von zwei nicht nur verschiedenen, sondern auch getrennten Naturen in Christus missverstanden werden, und sie ist deshalb eine wesentliche Ursache der Spaltungen nach dem Konzil von Chalkedon geworden. Von daher drängte sich die weitere Aufgabe auf, die Weise der Einheit zu klären, die zwischen dem wahren Menschsein und dem wahren Gottsein in Christus besteht. Das grosse Verdienst des Dritten Konzils von Konstantinopel besteht dabei darin, dass es die chalkedonische Aussage, dass Christus eine Person in zwei Naturen ist, wesentlich auf ihre personalen und existentiellen Dimensionen hin vertiefte, und zwar dadurch, dass es von der Überzeugung ausging, „dass zur Vollständigkeit der menschlichen Natur auch die denkbar höchste Vollkommenheit der Aktuierung dieser Natur gehört“, und dass es deshalb Christus auch „ein wirklich menschliches Wollen“ zusprach[23]. Indem das Konzil von daher der Frage nachging, wie in Christus zwei Willen miteinander leben und wirken können, hat es gelehrt, dass der menschliche Wille Jesu mit dem Willen des Logos ganz eins und damit reines Ja zum Willen des Vaters ist. Dies bedeutet, dass der menschliche Wille Jesu auf keinen Fall geleugnet werden darf, dass aber auch nicht zwei verschiedene Willenskräfte nebeneinander stehen, sondern dass die beiden Willen Jesu wirklich geeint sind im Ja-Wort des menschlichen Willens Jesu zum göttlichen Willen des Logos, wobei die beiden Willen nicht in naturaler, sondern in personaler Weise ein Wille sind. Da der Wille des Menschen Jesus nicht vom göttlichen Willen absorbiert ist, sondern in Freiheit ein einziger Wille in ihm ist, kann die Einheit des Menschen Jesus mit Gott keine Minderung oder gar Amputation des Menschseins Jesu bedeuten, sondern wird diese Einheit des Menschseins und seiner Freiheit vielmehr zur Vollendung gebracht: „Wenn Gott sich seinem Geschöpf Mensch verbindet, so verletzt und verringert er es nicht; er bringt es erst zu seiner vollen Ganzheit.“[24]
Diese personale Synthese der Freiheiten[25], deren denkerischen Durchdringung sich im siebten Jahrhundert der grosse Theologe Maximus Confessor gewidmet hat, dessen Theologie Hans Urs von Balthasar ins christologische Gespräch der jüngeren Vergangenheit eingebracht hat[26], hat gewiss in einer grundlegenden Weise die gemeinsamen christologischen Erklärungen in den zurück liegenden ökumenischen Dialogen beeinflusst und ermöglicht. Von daher drängt sich die zweite Konsequenz aus den bisherigen Überlegungen auf, nämlich die Frage nach der bleibenden Aktualität dieser christologischen Erklärungen in der kirchlichen und ökumenischen Situation heute. Diese Frage ist deshalb äusserst bedrängend, weil sich das Glaubensbewusstsein in der heutigen Situation von den christologischen Grundüberzeugungen des Konzils von Chalkedon und der christologischen Erklärungen in der jüngeren Vergangenheit in einer grundlegenden Weise unterscheidet. Denn im durchschnittlichen Glaubensbewusstsein heute geht es nicht mehr um die Alternative zwischen der Zwei-Naturen-Formel oder der Mia-Physis-Formel; die heutige Situation müsste eher in der Formel zum Ausdruck gebracht werden: „Jesus als Mensch ja – Christus als Sohn Gottes nein“. Viele Menschen und selbst Christen lassen sich zwar durchaus berühren von den menschlichen Dimensionen in Jesus von Nazareth; ihnen bereitet aber das Bekenntnis, dieser Jesus sei der eingeborene Sohn Gottes, der als der Auferweckte und in der Person des Heiligen Geistes unter uns gegenwärtig ist, und insofern der kirchliche Christusglaube weithin Mühe. Selbst innerhalb der Kirche will es heute oft nicht mehr gelingen, in Jesus nicht einfach einen – wenn auch hervorragenden und besonders guten – Menschen zu sehen, sondern im Menschen Jesus das Antlitz des Sohnes Gottes selbst wahrzunehmen. Es ist zwar erstaunlich und auch erfreulich, dass auch heute in der kritischen Situation, in der sich das Christentum besonders in Europa befindet, die Gestalt Jesus von Nazareth gegenwärtig ist und dass seine Gestalt sogar ausserhalb des Christentums auf die Menschen zugeht, bis hin nach Indien, wo viele Hindus das Bild von Jesus in ihr Haus und ihr Herz aufgenommen haben. Darüber dürfen wir uns auch als Christen freuen. Doch mit der Wahrnehmung einer vielfältigen Gegenwart der Gestalt Jesus auch in der heutigen Welt müssen wir zugleich in der heutigen Christenheit einen beunruhigenden Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens an Jesus als den Christus feststellen, in dem Gott selbst Mensch geworden ist.
Mit diesem christologischen Bekenntnis aber steht und fällt der christliche Glaube. Denn wenn Jesus, wie heute selbst nicht wenige Christen annehmen, nur ein Mensch gewesen wäre, der vor zweitausend Jahren gelebt hat, dann wäre er unwiderruflich in die Vergangenheit zurück getreten, und nur unser eigenes fernes Erinnern könnte ihn mehr oder weniger deutlich in unsere Gegenwart bringen. So aber könnte Jesus nicht „Gott von Gott“ und „Licht vom Licht“ und damit auch jenes Licht sein, das uns Menschen in unserer Lebensnacht aufsucht und heimsucht. Nur wenn der kirchliche Glaube wahr ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist und Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und so Anteil hat an der Gegenwart Gottes, die alle Zeiten umgreift, schenkt Jesus Christus nicht bloss gestern, sondern auch heute seine Gegenwart mitten unter uns Menschen.
2. Die christologische Frage in den katholisch-protestantischen Dialogen
Die Beschäftigung mit den gemeinsamen christologischen Erklärungen wird von daher auch zur Gewissensfrage, wie es um den Christusglauben in der Kirche und in der Ökumene heute steht. Diese Gewissensfrage stellt sich dabei nicht nur im Blick auf den ökumenischen Dialog zwischen Ost und West, sondern auch im Blick auf den ökumenischen Dialog in der Westkirche. Von christologischen Erklärungen ist in der heutigen ökumenischen Situation zwar zumeist nur im Zusammenhang der Dialoge mit den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen die Rede. Doch auch in den katholisch-protestantischen Dialogen stehen hinter nicht wenigen bisher kontrovers verhandelten Themen auch christologische Fragen, auf die kurz hingewiesen werden soll, zumal im gegenwärtigen Jahr des Reformationsgedenkens.
a) Rechtfertigungslehre und Christologie
Diese Annahme lässt sich vor allem verifizieren bei der Rechtfertigungslehre, die die wohl zentralste Frage gewesen ist, die im 16. Jahrhundert zur Reformation und anschliessend zur Kirchenspaltung geführt hat, über die aber in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“, die vom Lutherischen Weltbund und vom Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen am 31. Oktober 1999 in Augsburg unterzeichnet worden ist, ein weitgehender Konsens erzielt werden konnte, der als ökumenischer Meilenstein gewürdigt werden darf. Bei diesem erfreulichen differenzierenden Konsens sind dennoch einige Fragen offen geblieben, die vor allem das Verhältnis zwischen Glaube und Werk und - ihm zugrundeliegend - das Verhältnis zwischen dem Wirken der Gnade Gottes und dem freien Mitwirken des Menschen betreffen. Dass damit ein schwieriger und sensibler Punkt im ökumenischen Gespräch zwischen Katholiken und Lutheranern angesprochen ist, lässt sich auch daran ablesen, dass die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ eigens hervorhebt, dass Katholiken, wenn sie an der „Verdienstlichkeit“ der guten Werke festhalten, damit die „Verantwortung des Menschen für sein Handeln herausstellen“ wollen, damit aber „nicht den Geschenkcharakter der guten Werke bestreiten, geschweige denn verneinen, dass die Rechtfertigung selbst unverdientes Gnadengeschenk bleibt“ [27].
Gemäss der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ besteht ökumenischer Konsens darin, dass die Rechtfertigung des Menschen nicht durch seine Werke, sondern allein durch die Gnade Gottes und ihre Annahme im Glauben geschieht. Demgemäss bedeutet und impliziert „Gerechtigkeit“ nicht mehr – wie in der aristotelischen Tradition, in der der Mensch dadurch gerecht wird, dass er gerecht handelt - ein Tun, sondern ein Sein durch Gott: „Geschenk Gottes im Glauben an Jesus Christus“[28]. Damit aber stellt sich erst recht die Frage, ob die Bedingungslosigkeit der rechtfertigenden Gnade Gottes ein von ihr ermöglichtes und getragenes Mittun des Menschen zulässt und sogar freisetzt oder ob die Alles-Wirksamkeit Gottes auch seine Allein-Wirksamkeit bedeutet, mit der aufseiten des Menschen bloss noch reine Passivität angenommen werden könnte und müsste.[29] Während die protestantische Tradition dahin tendiert, diese Frage zu bejahen, betont die katholische Tradition, dass die Alles-Wirksamkeit Gottes die menschliche Mitwirkung auch und gerade im sakramentalen Leben der Kirche und im sittlichen Leben fördert und fordert. Auch in katholischer Sicht empfängt der Mensch zwar alles, was er ist und tun kann, von Gott und bleibt das menschliche Tun stets inkommensurabel mit dem, was Gott uns schenkt. Da aber der biblisch offenbare Gott ein wirklicher Gott der Beziehung ist und deshalb den Menschen zum Gegenüber zu sich selbst beruft, wird er von Gott zum Mitwirken mit ihm gerufen und zählt vor ihm trotz aller Inkommensurabilität das, was der Mensch ist und tut. Der Mensch ist deshalb nicht nur Objekt des Heilshandelns Gottes, sondern wirkt als Subjekt des Glaubens auch mit, wie der Katechismus der Katholischen Kirche hervorhebt: „Die Rechtfertigung begründet ein Zusammenwirken zwischen der Gnade Gottes und der Freiheit des Menschen. Sie äussert sich dadurch, dass der Mensch dem Wort Gottes, das ihn zur Umkehr auffordert, gläubig zustimmt und in der Liebe mit der Anregung des Heiligen Geistes zusammenwirkt, der unserer Zustimmung zuvorkommt und sie trägt.“[30]
Diese ökumenisch bedeutsame Frage lässt sich letztlich nur mit der Christologie und Soteriologie in adäquater Weise beantworten. Auf der einen Seite versteht es sich im christlichen Glauben von selbst, dass es sich beim Rechtfertigungsgeschehen eindeutig um einen Vorgang handelt, der von Gott her auf den Menschen zu geht. Die entscheidende Mitte des Christusglaubens besteht gerade nicht im Zorn Gottes, den der Mensch besänftigen müsste, sondern in der Liebe Gottes, mit der er den Menschen frei liebt. Nicht der Mensch versöhnt Gott, sondern Gott vergibt in freier Liebe dem Menschen. Der Tod Jesu am Kreuz ist keineswegs der Kaufpreis, den eine sühnende Menschheit Gott, der wegen der Sünde der Menschen beleidigt ist, übereicht; der Tod Jesu ist vielmehr die Selbstpreisgabe Gottes und seiner Liebe für uns Menschen. Diese katabatische Dimension der Christologie und Soteriologie ist für den christlichen Glaubens grundlegend. Sie darf aber auf der anderen Seite die anabatische Dimension der Christologie nicht zum Verschwinden bringen. Denn Jesus Christus ist nicht nur der zu uns Menschen herabsteigende Gott; er ist vielmehr auch der zu Gott aufsteigende Mensch: „Jesus ist nicht nur die Epiphanie der göttlichen Liebe, streng von oben nach unten zu sehen und zu verstehen, er ist auch Repräsentant der Menschheit, in dem die menschliche Natur sich selbst, ihr Köstlichstes und Reinstes Gott übereignet.“[31] Auch und gerade der Kreuzestod Jesu ist nicht nur als liebende Selbstpreisgabe Gottes an uns Menschen zu verstehen, sondern auch als das ohne Vorbehalt liebende Sich-Ausliefern des Menschen Jesus an Gott. Denn die katabatische und die anabatische Dimension des Erlösungsgeschehens lassen sich nicht trennen, sie greifen vielmehr ineinander, oder mit anderen Worten: das Versöhnungsgeschehen ist „kein Deszendenzgeschehen ohne Aszendenzgeschehen“[32].
b) Glaube an Jesus Christus und Leben in seinem Leib
Im Licht dieser christologisch-soteriologischen Grundperspektive stellt sich eine weitere Frage, die freilich in der ökumenischen Diskussion nur spärlich behandelt wird und auch in den christologischen Erklärungen kaum angesprochen ist, aber von grundlegender Bedeutung ist, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Christus und der Kirche, die sein Leib ist. Für Paulus versteht sich dieses Verhältnis von selbst und er sieht es in der Taufe begründet, von der er sagt, wir alle seien in ihr „in einen einzigen Leib“ aufgenommen (1 Kor 12, 13). Mit diesem Bild wagt es Paulus, Christus und Kirche auf das Engste miteinander zu verbinden. Damit will er natürlich Christus und Kirche in keiner Weise miteinander identifizieren. Denn die Kirche bleibt die Magd, die sich am Willen Christi zu orientieren hat. Und Christus ist das Haupt seines Leibes, das es radikal ernst zu nehmen gilt, da ein Leib ohne Haupt kein Leib mehr ist, sondern ein Leichnam. Auf der anderen Seite lassen sich aber Christus und Kirche auch nicht voneinander trennen; Christus und Kirche bilden in der Sicht des Paulus vielmehr einen Leib, freilich in dem analogen Sinne, in dem Bräutigam und Braut ein Fleisch und damit ein Leib werden und damit in der Weise, dass sie in ihrer unlöslichen geistigen und leiblichen Vereinigung dennoch unvermischt bleiben.
Mit diesem gewiss gewagten Bild will Paulus den wichtigen Sachverhalt in Erinnerung rufen, dass „in Christus sein“ als Geschenk der Taufe gleichbedeutend ist mit „im Leib Christi“ sein und dass folglich Zugehörigkeit zu Christus und Gliedschaft in der Kirche als seinem Leib unlösbar zusammen gehören. Sie lassen sich nicht voneinander trennen, wie allerdings ein Slogan vorgibt, der vor einigen Jahrzehnten Mode geworden ist und besagt: „Jesus ja – Kirche nein“. Zwischen Jesus und der Kirche kann es aber keinen Widerspruch geben, und zwar trotz der vielen Sünden der Menschen, die die Kirche bilden. Der Slogan „Jesus ja – Kirche nein“ ist mit der Intention Jesu nicht vereinbar und deshalb nicht christlich, wie Papst Benedikt XVI. mit wünschenswerter Klarheit betont hat: „Dieser individualistisch ausgesuchte Jesus ist ein Phantasie-Jesus. Wir können nicht Jesus ohne jene Wirklichkeit haben, die er geschaffen hat und in der er sich mitteilt. Zwischen dem fleischgewordenen Sohn Gottes und seiner Kirche gibt es eine tiefe, untrennbare und geheimnisvolle Kontinuität, kraft der Christus heute in seinem Volk gegenwärtig ist.“[33] Um diese tiefe Sicht des Glaubens zu unterstützen, hat Papst Franziskus das eindrückliche Bild von Name und Nachname des Christen verwendet: „Wenn der Name lautet <Ich bin Christ>, so lautet der Nachname <Ich gehöre zur Kirche>.“ Es kann deshalb gar keine rein individuellen Christen geben. Die christliche Identität besteht vielmehr in der Zugehörigkeit: „Wir sind Christen, weil wir zur Kirche gehören.“[34]
Da die Taufe den Täufling in die Kirche als in den Leib Christi eingliedert, können wir Christus nicht ohne seinen Leib haben. Dabei handelt es sich freilich um eine Aussage, die in den ökumenischen Gesprächen noch keineswegs geklärt ist. Wenn wir aber die intime Zusammengehörigkeit von Christus und seiner Kirche, die sein Leib ist, bedenken, dann ergibt sich eine elementare Einsicht für die ökumenische Verantwortung. Es wird uns neu bewusst, dass Jesus nur eine Kirche gewollt hat und es letztlich nur eine Kirche geben kann. Vielleicht ist es in der heutigen ökumenischen Situation notwendig, diese Glaubenswahrheit einmal in pointierter Weise auszudrücken: Da die Beziehung Christi zu seinem Leib so eng ist, dass man von einem Verhältnis zwischen Bräutigam und Braut sprechen darf, sind wir zur Rechenschaft des Glaubens verpflichtet, dass Christus auf keinen Fall polygam, sondern konsequent monogam ist. Christus hat nicht viele Leiber, sondern verbindet sich mit dem einen Leib seiner Kirche.
Die ökumenische Suche nach der sichtbaren Darstellung dieses einen Leibes Christi ist für die Glaubwürdigkeit des Christusglaubens von grundlegender Bedeutung.[35] Sie entspricht ganz der Sinnrichtung des Hohepriesterlichen Gebetes Jesu, in dem er um die Einheit unter seinen Jüngern mit der spezifischen Intention gebetet hat, „damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich“ (Joh 17, 23). Mit diesem Finalsatz kommt unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Einheit unter den Jüngern kein Selbstzweck ist, sondern im Dienst an der Glaubwürdigkeit der Sendung Jesu Christi und seiner Kirche in der Welt steht und die unerlässliche Voraussetzung für ein glaubwürdiges Zeugnis in der Welt darstellt.
Damit dringen wir bis in die innerste Mitte der christologischen Frage in den ökumenischen Dialogen vor. Die Christologie ist nicht einfach ein Thema, das neben anderen Themen in den ökumenischen Gesprächen zu behandeln ist, wobei nicht nur die theo-ontologische Konstitution Jesu Christi, sondern auch sein Verhältnis zu seinem Leib zu bedenken ist. Doch in einem viel grundlegenderen Sinn ist die ökumenische Suche nach der sichtbaren Einheit der Kirche selbst ein elementares christologisches Thema. Mit ihm ist die Verheissung verbunden, dass Christen umso mehr zueinander finden werden, desto mehr sie sich in Christus hinein verwurzeln. Wer in das Geheimnis Jesu Christi eintaucht, wird in seinem Leib wieder auftauchen. Hier liegt der tiefste Grund, dass Jesus Christus unmöglich ein Motiv der Trennung sein kann, sondern Grund der Einheit unter den Christen sein muss und ist. So verhält es sich jedenfalls, wenn Christen ihren eigenen Namen ernst nehmen und sich als Brüder und Schwestern Jesu Christi und deshalb als Brüder und Schwestern untereinander in Jesus Christus verstehen und als sein Leib in der Welt leben.
[1]. P. Hünermann (Hrsg.), Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (Freiburg i. Br. 1991) Nr. 301 und 302.
[2]. J. Ratzinger, Was bedeutet Jesus Christus für mich? in: Ders., Dogma und Verkündigung (München 1973) 137-140, zit. 138.
[3]. Vgl. Ch. Lange – K. Ponggéra (Hrsg.), Die altorientalischen Kirchen. Glaube und Geschichte (Darmstadt 2010); P. Siniscalco, Le Antiche Chiese Orientali. Storia e letteratura (Roma 2005).
[4]. P. Hünermann (Hrsg.), Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (Freiburg i. Br. 1991) Nr. 125.
[5]. Vgl. Th. Hainthaler, „Jesus der Christus im Glauben der Kirche“. Christologische Forschungen und ökumenischer Dialog mit Kirchen des Ostens, in: Catholica 71 (2017) 183-204.
[6]. A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Band 2/1: Das Konzil von Chalcedon (451). Rezeption und Widerspruch (451-518) (Freiburg i. Br. 1986) VII-VIII.
[7]. F. König, Offen für Gott – offen für die Welt. Kirche im Dialog (Freiburg i. Br. 2005) 72-73.
[8]. Vgl. D. Winkler, Ökumene zwischen Stolper- und Meilensteinen. Der Dialog von Pro Oriente mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen, in: J. Marte, R. Prokschi (Hrsg.), Denkwerkstatt Pro Oriente. Erfolgsgeschichte eines Ost-West-Dialogs (1964-2014) = Pro Oriente Band XXVIII (Innsbruck-Wien 2014) 100-123.
[9]. Vgl. E. Ch. Suttner, Vorchalcedonische und chalcedonische Christologie. Die eine Wahrheit in unterschiedlicher Begrifflichkeit, in: Ders., Kirche in einer zueinander rückenden Welt. Neue Aufsätze zu Theologie, Geschichte und Spiritualität des christlichen Ostens (Würzburg 2003) 155-170.
[10]. Gemeinsame Erklärung des Papstes Paul VI. und des syrischen Patriarchen von Antiochien Mar Ignatius Yaqub III. vom 27. Oktober 1971, in: H. Meyer, H. J. Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. 1931-1982 (Paderborn – Frankfurt a. M. 1983) 528-529.
[11]. Erklärung von Papst Johannes Paul II. und dem syrisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochien und dem Ganzen Osten, Ignatius Zakka I. Iwas, zu gegenseitigen pastoralen Hilfen 23. Juni 1984, in: H. Meyer, D. Papandreou, H. J. Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 2: 1982-1990 (Paderborn – Frankfurt a. M. 1992) 571-574.
[12]. Vgl. J. Oeldemann, Gemeinsamer Glaube und pastorale Zusammenarbeit. 25 Jahre Weggemeinschaft zwischen der Syrisch-Orthodoxen Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche (Basel 2011).
[13]. Th. Hainthaler, Die Gemeinsame Erklärung vom 23. Juni 1984. Theologische Aussage und ökumenische Bedeutung, in: J. Oeldemann, Gemeinsamer Glaube und pastorale Zusammenarbeit (Basel 2011) 24-51, zit. 27.
[14]. Gemeinsame Erklärung des Papstes Paul VI. und des koptischen Papst-Patriarchen Shenuda III. vom 10. Mai 1973, in: H. Meyer, H. J. Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. 1931-1982 (Paderborn – Frankfurt a. M. 1983) 529-531.
[15]. Gemeinsame Erklärung von Papst Johannes Paul II. und dem Obersten Patriarchen und Katholikos aller Armenier, Karekin I., Rom, 13. Dezember 1996, in: H. Mayer, D. Papandreou, H. J. Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 3: 1990-2001 (Paderborn – Frankfurt a. M. 2003) 582-584.
[16]. Gemeinsame Erklärung von Katholikos Aram I. von Kilikien und Papst Johannes Paul II., Rom, 25. Januar 1997, in: a.a.O. (Anm. 16) 584-587.
[17]. Vgl. Th. Hainthaler, Hermeneutische Aspekte bei christologischen Erklärungen mit den Kirchen des Ostens, in: S. Ernst, G. Gäde (Hrsg.), Glaubensverantwortung in Theologie, Pastoral und Ethik = Festschrift für Peter Knauer (Freiburg i. Br. 2015) 146-171.
[18]. Erklärung über die Christologie der Gemeinsamen Kommission der Katholischen Kirche und der Koptisch-Orthodoxen Kirche (Wien, 26.-29. August 1976), in: H. Meyer, H. J. Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. 1931-1982 (Paderborn – Frankfurt a. M. 1983) 541-542.
[19]. Erklärung der Gemeinsamen Kommission der Römisch-Katholischen Kirche und der Malankarischen Syrisch-Orthodoxen Kirche, 3. Juni 1990, in: H. Meyer, D. Papandreou, H. J. Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 2: 1982-1990 (Paderborn – Frankfurt a. M. 1992) 578-580.
[20]. Gemeinsame christologische Erklärung der Katholischen Kirche und der Assyrischen Kirche des Ostens, Rom, 11. November 1994, in: H. Meyer, D. Papandreou, H. J . Urban, L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 3: 1990-2001 (Paderborn – Frankfurt a. M. 2003) 597-601, zit. 597.
[21]. Gregor von Nazianz, Ep. 130 Ad Procopium.
[22]. J. Kardinal Ratzinger, Bilanz der Nachkonzilszeit – Misserfolge, Aufgaben, Hoffnungen, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (München 1982) 383-395, zit. 385.
[23]. K.-H. Menke, Jesus ist Gott der Sohn. Denkformen und Brennpunkte der Christologie (Regensburg 2008) 271.
[24]. J. Kardinal Ratzinger, Christologische Orientierungspunkte, in: Ders., Schauen auf den Durchbohrten. Versuche zu einer spirituellen Christologie (Einsiedeln 1984) 13-40, zit. 34.
[25]. Vgl. K. Koch, In Liebe erlöste Freiheit. Besinnung auf das anthropologische Geheimnis des Christusglaubens, in: G. Augustin / M. Brun / E. Keller / M. Schulze (Hrsg.), „Christus – Gottes schöpferisches Wort“. Festschrift für Christoph Kardinal Schönborn (Freiburg i. Br. 2010) 371-402.
[26]. H. U. von Balthasar, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners (Freiburg i. Br. 1941).
[27]. Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche, in: H. Meyer / D. Papandreou / H. J. Urban / L. Vischer (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 3: 1990-2001 (Paderborn – Frankfurt a. M. 2003) 419-441, zit. 429.
[28]. Ch. Schad, Rechtfertigung: Gottes Ja zu uns! in: H. Schier / H.-G. Ulrichs (Hrsg.), Nötig zu wissen. Heidelberger Beiträge zum Heidelberger Katechismus (Heidelberg 2012) 103-107, zit. 105.
[29]. Vgl. K. Koch, Der Heidelberger Katechismus in katholischer Sicht heute, in: M. E. Hirzel, F. Mathwig, M. Zeindler (Hrsg.), Der Heidelberger Katechismus – ein reformierter Schlüsseltext = reformiert! Band 1 (Zürich 2012) 287-306.
[30]. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1993.
[31]. J. Ratzinger, Theologie und Verkündigung im Holländischen Katechismus, in: Ders., Dogma und Verkündigung (München 1973) 65-83, zit. 77.
[32]. K.-H. Menke, Das unterscheidend Christliche. Beiträge zur Bestimmung seiner Einzigkeit (Regensburg 2015) 67.
[33]. Benedikt XVI., Katechese bei der Generalaudienz am 15. März 2006.
[34]. Franziskus, Katechese bei der Generalaudienz am 25. Juni 2014.
[35]. Vgl. K. Kardinal Koch, Lob der Vielfalt - Gerät den christlichen Kirchen die Einheit aus dem Blick? in: St. Kopp / W. Thönissen (Hrsg.), Mehr als friedvoll getrennt? Ökumene nach 2017 (Freiburg i. Br. 2017) 15-40.