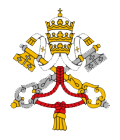DAS VERHÄLTNIS DES CHRISTLICHEN GLAUBENS ZUR WELT
IN ÖKUMENISCHER PERSPEKTIVE
Vortrag bei der Ökumenischen Konferenz „Gott und die Welt“
in der Erzabtei Pannonhalma in Ungarn am 8. Juni 2021
Kurt Cardinal Koch
Einheit von Schöpfung und Erlösung
In den Credos der Kirche bekennen wir Gott als Schöpfer Himmels und der Erde, als Erlöser des Menschen und der Welt und als Vollender seiner Schöpfung. Mit diesem dreigliedrigen Aufbau, der dem Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes nachgebildet ist, bringen wir unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass Schöpfung und Erlösung unlösbar zusammengehören. Diese Überzeugung liegt auch den christlichen Festen zugrunde. In der Liturgie des Hochfestes von Pfingsten beispielsweise folgt auf die Lesung aus der Apostelgeschichte, in der die Geburt der Kirche durch das Herabkommen des Heiligen Geistes auf die Versammlung der Jünger berichtet wird, als Antwort Psalm 104, der ein Lobpreis der Schöpfung und auf den Schöpfer ist, der das All in Weisheit geschaffen hat, und in dem die schönen Verse zu meditieren sind: „Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen“ (Ps 104, 24). Diese Zuordnung von Lesung und Antwortpsalm erinnert an die geschichtliche Entwicklung, dass Pfingsten ursprünglich ein Fest der Schöpfung, genauer ein Erntefest gewesen, in Israel zum Fest der Erinnerung an die Ereignisse am Sinai geworden ist und im Christentum als Erneuerung des Sinaigeschehens und damit als Geburtsfest der Kirche gefeiert wird. In der Liturgie des Pfingstfestes wird damit sichtbar, dass der christliche Erlösungsglaube und das Bekenntnis zum Schöpfergott untrennbar miteinander verbunden sind und dass christliche Liturgie immer eine elementar kosmische Dimension aufweist[1]. Der deutsche Philosoph Josef Pieper hat deshalb den innersten Kern eines Festes als „Zustimmung zur Welt“ bezeichnet[2]. Da ein Fest immer dann gegeben ist, wenn Menschen Ja sagen und wenn sie der Welt, dem Sein überhaupt und darin sich selbst zustimmen können, weil sie dem Grund ihrer selbst und damit dem Grund ihres Lebens, nämlich Gott zustimmen, bedeutet ein Fest immer Bejahung des Daseins und Bestätigung des Geschöpfseins.
Damit ist das Wesentliche im Verhältnis des christlichen Glaubens zur Welt ausgesagt, dass es nämlich ein positives Verhältnis ist, wie es bereits im biblischen Schöpfungsbericht zum Ausdruck gebracht wird: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut“ (Gen 1, 31). Dieses Prädikat erweist sich in der religiösen Geschichte der Menschheit als neu und einmalig wie einzigartig. Im Unterschied zu vielen religiösen Traditionen, die stets von einem gewissen Dualismus in dem Sinne geleitet sind, dass die Welt nicht aus einer Hand, und zwar einer guten stammt, sondern dass auch andere, nämlich unheimliche Mächte am Werk sind, kennt der biblisch offenbare Gott schlechterdings keinen Konkurrenten. Er allein und nicht behindert von irgendeinem Demiurgen ist der Schöpfer und der Herr der Welt. Deshalb ist die Welt sein Werk, und dieses Werk ist gut.
Der Mensch als Ebenbild Gottes und als Sünder
Was von der Welt im Allgemeinen zu sagen ist, gilt erst recht vom Menschen, der im biblischen Schöpfungsbericht als Abbild Gottes prädiziert wird: „Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1, 27). Mit dieser Bezeichnung ist die äusserst positive Zusage verbunden, dass der Mensch nicht irgendein Zufallsprodukt der Erde, sondern ein gewolltes und geliebtes „Projekt Gottes“ ist[3]. Damit ist die Höchstwürde des Menschen in dem Sinne zum Ausdruck gebracht, dass jedem, der das Antlitz eines Menschen trägt, göttlicher Rang und damit Unantastbarkeit zukommt.
Diese sehr positive Sicht des Menschen findet in der biblischen Tradition freilich ihre Kontrastfolie in der Tatsache, dass der Mensch nicht nur als Ebenbild Gottes, sondern auch als Sünder betrachtet wird. Der tiefste Gehalt der Sünde wird dabei darin gesehen, dass der Mensch sein Geschöpf-Sein leugnet und werden will wie Gott. Es fällt auf und muss zu denken geben, dass gerade das Bedenken des Sünder-Seins des Menschen zu konfessionell geprägten Sichten des Verhältnisses des christlichen Glaubens zur Welt im Allgemeinen und zum Menschen im Besonderen geführt hat.[4] Diese verschiedenen Sichten sind gerade in unterschiedlichen Interpretationen des biblisch-anthropologischen Fundamentalthemas der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet.
Die katholische Tradition ist weitgehend vom Bemühen geprägt, die im alttestamentlichen Buch Genesis grundgelegte Unterscheidung und Zuordnung von Imago und Similitudo im Blick auf die besondere Würde des Menschen hervorzuheben und deshalb zu betonen, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen durch die Sünde zwar beschädigt worden, aber nicht verloren gegangen ist. Die katholische Tradition hat von daher trotz aller Sündigkeit an der Geschöpflichkeit des Menschen in einem positiven Sinn festgehalten und hat sie darin wahrgenommen, dass der Mensch von Natur aus für Gott offen und für die Wahrheit Gottes empfänglich ist und dass die Natur des Menschen sich danach sehnt, von der Gnade Gottes aufgenommen und vollendet zu werden, gemäss dem katholischen Grundprinzip: „gratia supponit naturam et perficit eam“.
Die reformatorische Tradition hat demgegenüber eine sachliche Differenz von Imago und Similitudo verneint und die die Gottebenbildlichkeit des Menschen charakterisierenden Begriffe von Bild und Ähnlichkeit so stark miteinander identifiziert, dass, wie der evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg betont, „der Verlust der Urstandsgerechtigkeit Adams durch den Sündenfall nun auch den Verlust der Gottebenbildlichkeit des Menschen bedeuten musste“[5]. Diese sehr pessimistische Sicht des Menschen kommt in einer emphatischen Weise im reformierten Heidelberger Katechismus zum Ausdruck[6], und zwar dadurch, dass der ganze erste Teil vom Elend des Menschen handelt. Es wird zwar kurz festgehalten, dass Gott den Menschen „gut und nach seinem Ebenbild erschaffen“ hat[7]; dann jedoch wird sofort zur Feststellung übergegangen, dass aufgrund des Ungehorsams und Falls von Adam und Eva im Paradies die Natur des Menschen „vergiftet“ ist[8] und das Elend des Menschen darin besteht, dass der Mensch von Natur aus geneigt ist, „Gott und meinen Nächsten zu hassen“[9]. Das Elend des Menschen wird am tiefsten in seiner Unfähigkeit wahrgenommen, Gott und seine Nächsten zu lieben, so dass Jesu Gebot der Gottes- und Nächstenliebe den Menschen erst recht mit seinem Elend konfrontiert, wie überhaupt die Zehn Gebote in der Sicht des Heidelberger Katechismus den primären Sinn darin haben, „damit wir unser ganzes Leben lang unsere sündliche Art je länger je mehr erkennen“[10]. Von der Geschöpflichkeit des Menschen und vor allem von der gütigen Providenz Gottes für den Menschen ist im Heidelberger Katechismus zwar durchaus auch die Rede; doch die Insistenz auf dem Elend des Menschen ist so stark konturiert, dass die „reformatorische Einsicht von der grundsätzlichen Bosheit des Menschen“[11] die Geschöpflichkeit des Menschen kaum mehr als eine positive Wirklichkeit wahrzunehmen vermag.
In der christlichen Anthropologie werden damit konfessionelle Unterschiede sichtbar, die man in gewiss zugespitzter Weise so auf den Begriff bringen kann: Die katholische Tradition geht von der fundamentalen Überzeugung aus, dass die Natur des Menschen zwar von der Sünde infiziert ist, jedoch wesengemäss gut bleibt; sie ist in der Folge von einem schöpfungstheologischen Optimismus geprägt. Die reformatorische Tradition zeichnet sich dem gegenüber aufgrund ihrer Annahme einer weitgehenden oder gar totalen Zerstörung der menschlichen Natur durch die Sünde eher durch einen hamartiologischen Pessimismus aus.[12] Hinter diesen konfessionellen Unterschieden dürfte sich eine unterschiedliche Sicht des Verhältnisses von Transzendenz und Immanenz und dementsprechend von Eschatologie und Geschichte verbergen, worauf Walter Kardinal Kasper bereits in den Anfängen der ökumenischen Dialoge den Finger gelegt hat: „Der Protestantismus ist erfüllt von der Transzendenz Gottes über der Geschichte, der Katholik leugnet diese Transzendenz nicht, aber er betont ebenso stark unsere Teilhabe am Leben Gottes und damit die Sakramentalität der christlichen Wirklichkeit.“[13]
Das Verhältnis von Transzendenz und Immanenz
Damit dürfte deutlich sein, dass die konfessionellen Unterschiede nicht einfach einzelne Lehren betreffen, sondern jeweils eine Gesamtsicht des Christlichen implizieren, die sich dann freilich bei der Thematisierung von einzelnen Lehren wie beispielsweise der Lehre von der Kirche und der Lehre von den Sakramenten auswirken. Diese verschiedenen Glaubensverständnisse müssen sich freilich, vorausgesetzt dass sie nicht absolut gesetzt werden, weder kontradiktorisch widersprechen nicht gegenseitig ausschliessen. Sie können sich vielmehr auch gegenseitig befruchten und bereichern. Dies kann aber nur einsichtig werden, wenn sie im grösseren Zusammenhang des Verhältnisses zwischen der Transzendenz Gottes und der Immanenz der weltlichen Wirklichkeit überhaupt betrachtet werden.
Die protestantische Tradition pflegt den Akzent auf die Differenz zwischen Gott und Welt, zwischen Schöpfer und Schöpfung, zwischen Transzendenz und Immanenz zu legen. In extremer Zuspitzung ist dies beim Züricher Reformator Huldrych Zwingli festzustellen, der im berechtigten Bestreben, jede Kreaturvergötterung auszuschliessen, auf einer strikten Trennung zwischen dem Göttlichen und dem Kreatürlichen bestanden hat, die nicht einmal durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes durchbrochen werden kann. Diese Insistenz auf der Differenz hat bei Zwingli zu einer konsequenten Abwehr des Sakramentalen geführt, wie vor allem bei seiner seltsam anmutenden Begründung für die Ablehnung der eucharistischen Realpräsenz deutlich wird, dass sich Christus nach seiner Himmelfahrt im Himmel aufhalte und deshalb nicht zugleich leiblich im Abendmahl auf Erden gegenwärtig sein könne.
Eine solche Betonung der Differenz zwischen Gott und Welt kann natürlich gute theologische Gründe für sich beanspruchen. Denn nur wo Differenz gegeben ist, wird in negativer Hinsicht einer drohenden Vergöttlichung der weltlichen Wirklichkeit gewehrt und wird in positiver Hinsicht das Gegenüber Gottes zur Welt ernst genommen und kann ein wirklicher Schöpfungsdialog stattfinden, weil der Schöpfergott seine Geschöpfe anzusprechen vermag. Dann jedoch, wenn die Differenz zwischen Transzendenz und Immanenz zu einer dualistischen Unterschiedenheit von Gott und Schöpfung gesteigert wird, kann die Gegenwart Gottes in der Welt und das Gegenwärtigsein der Schöpfung in Gott nicht mehr gedacht werden und wird letztlich die Konzeption einer Gott-losen Welt und eines Welt-losen Gottes vertreten, wie der katholische Dogmatiker Gisbert Greshake sensibel feststellt: „Einer Welt, die nicht mehr als Medium der Offenbarung Gottes erfahren wird, die also im wahrsten Sinne des Wortes gott-los ist, entspricht auf der anderen Seite ein welt-loser Gott. Ein solcher aber erwies sich im Fortgang der neuzeitlichen Geschichte immer mehr und erweist sich heute vollends als ein unwirklicher, illusionärer Gott.“[14]
Demgegenüber pflegt die katholische Tradition eher von einem gegenseitigen In-Sein von Schöpfer und Geschöpf und von Transzendenz und Immanenz auszugehen, und ist vom Anliegen getragen, aufgrund der Annahme einer grundlegenden Analogie die Immanenz Gottes in seiner Schöpfung zu betonen. In diesem Sinn hat Thomas von Aquin in seiner „Summa theologica“ die christliche Grundüberzeugung zum Ausdruck gebracht und vielfältig variiert, dass Gott „in allen Geschöpfen“ ist und unmittelbar wirkt als „der, der ihnen ihr Sein, ihre Kraft und ihre Aktivität“ gibt, so dass kein Geschöpf „so fern von Gott“ sein kann, „dass es ihn nicht in sich hätte“. In diesem Zusammenhang konnte der Aquinate sogar den erstaunlichen Vergleich wagen: „Wie die Seele ganz in jedem Teil des Körpers ist, so ist auch der ganze Gott in allen Geschöpfen und in jedem einzelnen.“[15] Eine ähnliche Sicht findet sich auch in den Spiritualitäten von bedeutenden Heiligen, beispielsweise in der Überzeugung des heiligen Benedikt, dass Gott in allem gelobt werden soll („ut sit in omnibus glorificetur Deus“) und im Leitmotiv des heiligen Ignatius von Loyola, dass Gott in allen Dingen gefunden werden kann.
Diese emphatische Betonung der Immanenz Gottes in seiner Schöpfung und der Schöpfung in ihm muss freilich mit der anderen Glaubensaussage zusammengehen, dass Gott sich selbst in seiner Schöpfung keineswegs voll und ganz verwirklicht, sondern bei aller Immanenz zugleich auch transzendent bleibt und sie unendlich übersteigt. Dort hingegen, wo die Weltimmanenz Gottes derart verabsolutiert würde, dass die Welttranszendenz Gottes aufgehoben wäre, würde die gefährliche Konzeption einer monistischen oder gar pantheistischen Identität von Gott und Welt und damit die Sakralisierung der Schöpfungswirklichkeit vertreten.
Die Transparenz der Transzendenz in der Immanenz
Ökumenische Theologie steht von daher vor der fundamentalen Aufgabe, die beiden genannten Extremkonzeptionen einer dualistischen Differenz zwischen Gott und Welt und einer monistischen Identität von Gott und Welt zu überwinden und die Weltimmanenz und die Welttranszendenz Gottes zugleich zur Geltung zu bringen. Denn zur Göttlichkeit Gottes gehört es, dass er nicht jenseits und ausserhalb seiner Schöpfung ist – als der von ihr nur Unterschiedene und ganz Andere -, sondern dass er im Logos aufgrund seiner Menschwerdung und in seinem Geist in jedem seiner Geschöpfe gegenwärtig ist. Zur Göttlichkeit Gottes gehört es aber ebenso, dass er nicht in der Schöpfung aufgeht oder gar mit ihr zusammenfällt – als der mit ihr Identische -, sondern dass er der Schöpfung gegenüber auch transzendent bleibt.
Beides zusammenzudenken, dass Gott als Schöpfer nicht nur der der Welt transzendente ist, sondern auch und gerade in seiner weltjenseitigen Unendlichkeit der der Welt immanente Gott ist, ist nur möglich, wenn man vom christlichen Kerngeheimnis der göttlichen Dreieinigkeit her denkt, worauf vor allem der evangelische Ökumeniker Wolfhart Pannenberg hingewiesen hat: „Der trinitarische Gott hebt, ohne Verwischung der Differenz von Schöpfer und Geschöpf , diesen Gegensatz auf im Gedanken der Versöhnung. Erst der trinitarisch gedachte Gott ist, ohne Beseitigung des Unterschieds von Gott und Geschöpf, sondern gerade durch Anerkennung dieses Unterschieds auf beiden Seiten, alles in allem.“[16]
Im Licht des Geheimnisses der göttlichen Trinität wird vollends deutlich, dass die Kategorien der Transzendenz und der Immanenz allein nicht genügen, um das Verhältnis Gottes zur Welt adäquat zu beschreiben. Diese Kategorien vermögen bloss die Tatsache zu erfassen, dass Gott nicht Welt und die Welt nicht Gott ist. Es bedarf vielmehr einer dritten Kategorie, nämlich derjenigen der Transparenz, die die Gegenwart der Transzendenz Gottes in der Immanenz der Schöpfung ausdrückt und die Immanenz der Schöpfung als den Ort verstehen lässt, an dem sich die Transzendenz Gottes anzeigt und verwirklicht.
Sakramentales Leben und Denken
Diese dritte Kategorie, die Transparenz der Transzendenz in der Immanenz und der Transparenz der Immanenz für die Transzendenz, lässt sich theologisch noch präziser mit dem christlichen Grundbegriff des Sakramentalen umschreiben. Dabei zeigen freilich nicht nur die so genannten Abendmahlsstreitigkeiten im 9. und 11. Jahrhundert, sondern auch ein Blick in die gegenwärtige Situation der Christenheit, dass die Realität des Sakramentalen und das theologische Denken über Sakramentalität eine elementare Herausforderung darstellen, die der katholische Theologe Theodor Schneider in diesen Worten ausgedrückt hat: „Das innere Sehen, das Erkennen der inneren Wirklichkeit im äusseren Geschehen, das bleibt das grosse Problem Gottes mit uns Menschen.“[17]
Eine Revitalisierung des sakramentalen Lebens und Denkens erweist sich heute als dringend notwendig, da nur im sakramentalen Denken sowohl der Transzendenz- als auch der Immanenz-Orientierung Rechnung getragen werden kann. Denn es macht das eigentliche und tiefste Wesen des Sakramentes aus, dass es gleichsam an zwei „Welten“ teilhat. Indem zum Ausdruck gebracht wird, dass die Wirklichkeit des Transzendenten im Bereich des Immanenten gegenwärtig ist, wird dieser zugleich transfiguriert und für das Transzendente transparent. Eine äussere Weltwirklichkeit wird zum sichtbaren und wirksamen Zeichen für eine innere und unsichtbare Wirklichkeit. Sakramentales Denken ist Erkennen der transzendenten Wirklichkeit im immanenten Bereich. So werden beispielsweise in der Feier der Eucharistie die Elemente von Brot und Wein zu wirksamen und realisierenden Zeichen der Gegenwart der Person und des Heilswerks Jesu Christi.
Geht man dieser Realität des Sakramentalen auf den Grund, legt es sich nahe, das eigentliche Verhältnis zwischen Gott und Welt im Gedanken der Verwandlung wahrzunehmen. Denn dieser Gedanke setzt das Weltliche voraus und macht es für das Göttliche transparent. Dies zeigt bereits die menschliche und menschheitliche Erfahrung, in der „Wandlung“ seit jeher ein Urwort ist. Alles, was lebt, befindet sich in Wandlung. Im Laufe eines Jahres wandelt sich die Natur immer wieder. Auch der menschliche Organismus wandelt sich nicht nur in den verschiedenen Lebensabschnitten; er ist vielmehr jederzeit in Wandlung begriffen, bei der immer wieder Neues geschieht. Von daher kann es nicht erstaunen, dass das Wissen um Wandlung auch zu den Urgegebenheiten des eucharistischen Glaubens gehört. Dies gilt vor allem von der Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi, die die katholische Tradition mit dem Begriff der Transsubstantiation beschrieben und damit zum Ausdruck gebracht hat, dass das, was in der Eucharistie geschieht, nicht Um-Funktionierung, sondern wirkliche Um-Wandlung von Brot und Wein und letztlich, wie Teilhard de Chardin es sehr tief geschaut hat, die antizipierende Feier der universalen Transsubstantiation des ganzen Kosmos in den Leib Jesu Christi ist.
Solidarischer Bezug und kritischer Kontrast
Von dieser Vision her zeigt sich, dass das Verhältnis des christlichen Glaubens zur Welt im Zeichen der Wandlung ein spannungsvolles Verhältnis darstellt, wie es in der Heiligen Schrift Jesus mit zwei Bildern zum Ausdruck bringt, wenn er von seinen Jüngern erwartet, dass sie „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ sind. Das erste Bild vom „Salz der Erde“ betont den solidarischen Bezug von uns Christen zur Welt. Wie im alltäglichen Leben das Salz im Küchenschrank nicht viel nützt und mit der Zeit schal wird, sondern erst wirksam wird, wenn man es in die Suppe streut, so kann auch das Salz des Evangeliums in der Sakristei der Kirche nicht viel bewirken; es muss vielmehr in unmittelbaren Kontakt mit der heutigen Welt gebracht werden. Das zweite Bild vom „Licht der Welt“ akzentuiert demgegenüber den notwendigen Kontrast von uns Christen gegenüber der Welt. Uns Christen ist damit zugemutet, Farbe zu bekennen, unsere eigene Physiognomie zu entwickeln und auch gegen den modischen Zeitgeist von heute mit prophetischer Stimme Stellung zu beziehen.
Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie sich in ihrem Verhältnis zur Welt immer als „Salz der Erde“ und damit in solidarischem Bezug zu ihr und zugleich als „Licht der Welt“ und damit in deutlichem Kontrast zu ihr erweisen und sich bewähren. Wir Christen sollen dabei nicht das Eine tun und das Andere lassen, sondern beides zugleich und versöhnt miteinander. Wie die Benediktiner und Franziskaner in der einen Kirche spannungsvoll zusammen leben, so sollen wir Christen zugleich benediktinisches „Licht der Welt“ und franziskanisches „Salz der Erde“ sein. Denn Kirche und Welt dürfen weder fundamentalistisch voneinander getrennt noch säkularistisch miteinander vermischt werden. Sie müssen vielmehr miteinander vermittelt und zugleich voneinander unterschieden werden. Oder um die christologische Formel von Chalkedon zu verwenden: Das Verhältnis zwischen Kirche und Welt muss „unvermischt und ungetrennt“ gestaltet sein. Dies ist der Weg des christlichen Glaubens, wie ihn uns das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Versöhnung zwischen evangelischer Ursprungstreue und kairologischer Zeitgemässheit gewiesen hat, und zwar in der Hoffnung, dass dieser Weg auch ökumenisch begehbar sein wird.[18]
[1] Vgl. J. Kardinal Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung (Freiburg i. Br. 2000), bes. 20-29: Liturgie – Kosmos – Geschichte.
[2] J. Pieper, Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes (München 1963).
[3] J. Ratzinger - Benedikt XVI., Der Mensch als Projekt Gottes, in: Ders., Gottes Projekt. Nachdenken über Schöpfung und Kirche (Regenburg 2009) 54-72.
[4] Vgl. K. Kardinal Koch, Der Mensch als ökumenische Frage. Gibt es (noch) eine gemeinchristliche Anthropologie? in: B. Stubenrauch / M. Seewald (Hrsg.), Das Menschenbild der Konfessionen. Achillesverse der Ökumene? (Freiburg i. Br. 2015) 18-32.
[5] W. Pannenberg, Gottebenbildlichkeit als Bestimmung des Menschen in der neueren Theologiegeschichte (München 1979) 8.
[6] Vgl. K. Koch, Der Heidelberger Katechismus in katholischer Sicht heute, in: M. E. Hirzel, F. Mathwig, M. Zeindler (Hrsg.), Der Heidelberger Katechismus – ein reformierter Schlüsseltext (reformiert! 1) (Zürich 2013) 287-306.
[7] Heidelberger Katechismus, Frage 6.
[8] Heidelberger Katechismus, Frage 7.
[9] Heidelberger Katechismus, Frage 5.
[10] Heidelberger Katechismus, Frage 115.
[11] P. Lampe, Homo homini lupus, in: H. Schwier / H.-G. Ulrichs (Hrsg.), Heidelberger Beiträge zum Heidelberger Katechismus (Heidelberg 2012) 27-35, zit. 29.
[12] Vgl. K. Koch, Der Gott der Geschichte. Theologie der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg als Paradigma einer Philosophischen Theologie in ökumenischer Perspektive (Mainz 1988), bes. 320-367: „Natürliche Theologie“ als kontroverstheologisches Problem.
[13] W. Kasper, Das Gespräch mit der protestantischen Theologie, in: Concilium 1 (1965) 334-344, jetzt in: Ders., Wege zur Einheit der Christen = Gesammelte Schriften. Band 14 (Freiburg i. Br. 2012) 237-261, zit. 244.
[14] G. Greshake, Gott in allen Dingen finden. Schöpfung und Gotteserfahrung (Freiburg i. Br. 1986) 24.
[15] Thomas von Aquin, Summa Theologica I, q. 8.
[16] W. Pannenberg, Probleme einer trinitarischen Gotteslehre, in: W. Baier u. a. (Hrsg.), Weisheit Gottes – Weisheit der Welt. Festschrift für J. Kardinal Ratzinger. Band 1 (St. Ottilien 1987) 329-341, zit. 341.
[17] Th. Schneider, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriss der Sakramententheologie (Mainz 1979) 18.
[18] Vgl. K. Kardinal Koch, Heutigwerden des Glaubens im Dialog zwischen Welt und Gott. Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils in der heutigen Situation des Christentums, in: St. Ley, I. Proft, M. Schulze (Hrsg.), Welt vor Gott. Für George Augustin (Freuburg i. Br. 2016) 231-242.